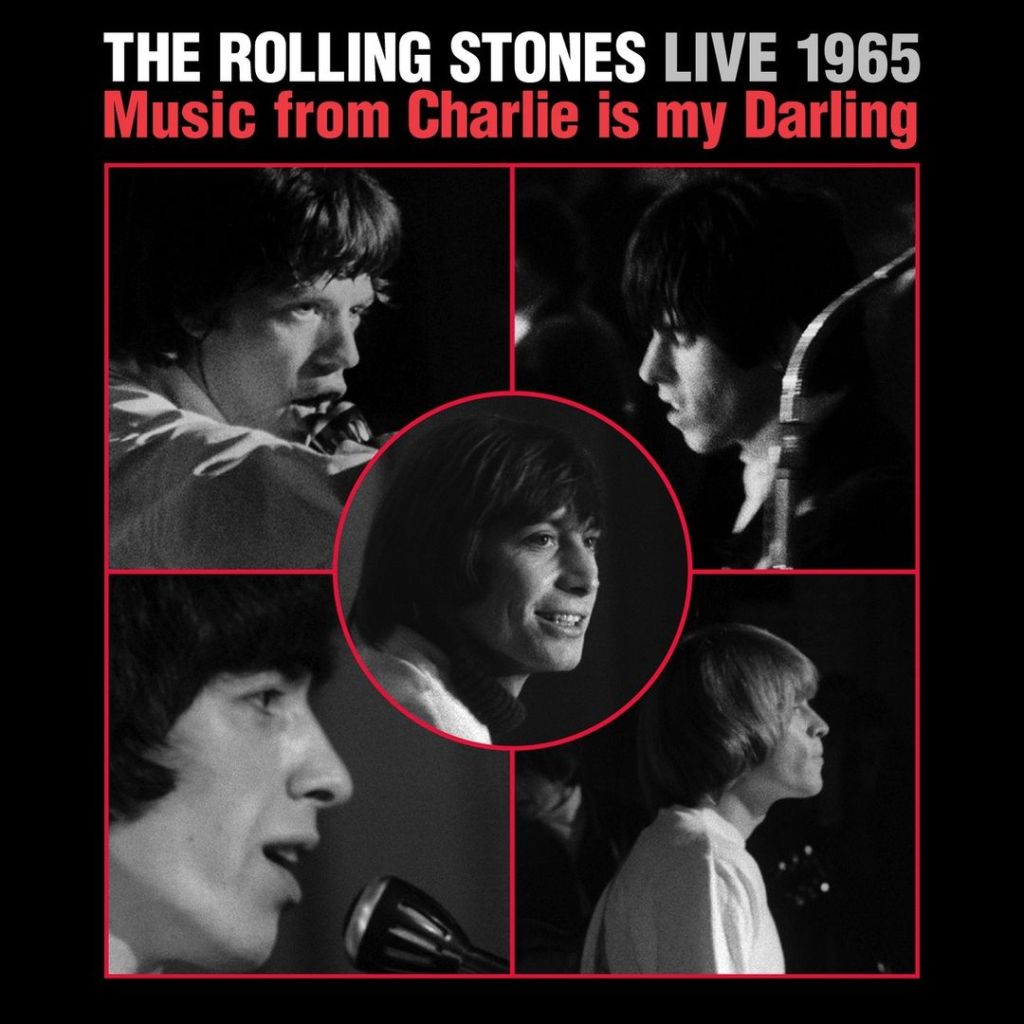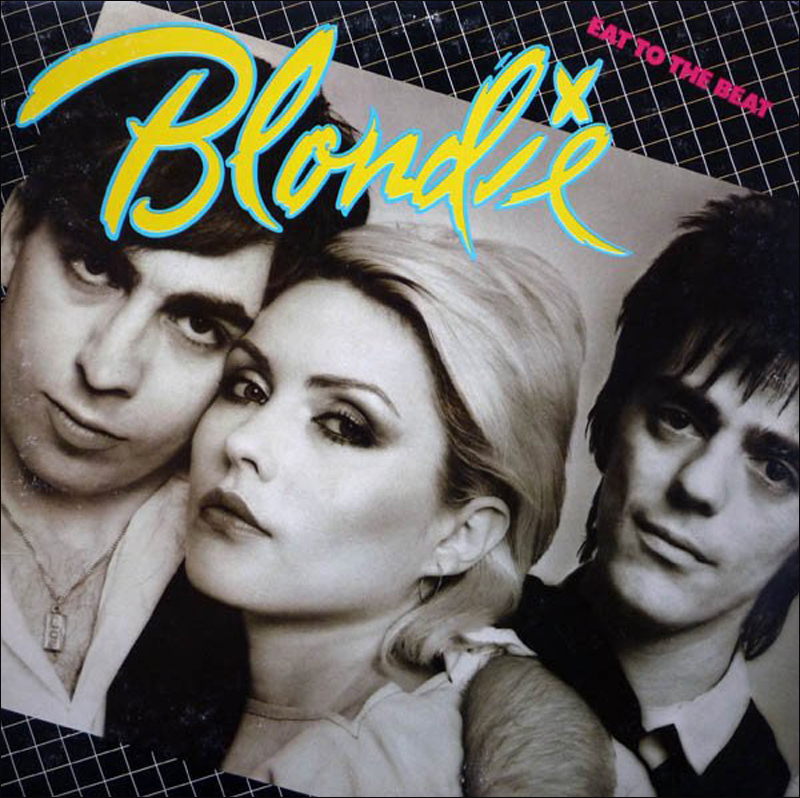Frank Zappa, Trouble Every Day, 1966
Text/Musik/ Frank Zappa
Produzent/ Tom Wilson
Label/ Verve
Die Republikaner seien von Gier zerfressen und die Demokraten vom Neid, keine Republikaner zu sein, sagte er. Aber das hinderte Frank Zappa nicht daran, sich in öffentliche Debatten einzumischen, die Leute zum Wählen aufzufordern und sich mit Politiker anzulegen, die Songtexte zensieren und damit die Redefreiheit einschränken wollten. Zuletzt war er von der Politik dermassen abgestossen, dass er 1991 ankündigte, er werde selber als Unabhängiger für die amerikanische Präsidentschaft kandidieren. Was er seinen politischen Konkurrenten voraus habe, wollten die Journalisten von ihm wissen. „Ich arbeite länger als sie“, gab er zurück. „Und ich bin wach.“ Und überhaupt: „Could I do any worse?“
Zappa konnte den Beweis nicht mehr antreten. Kurz nach Bekanntgabe seiner Kanditatur erkrankte er an Prostatakrebs und starb zwei Jahre später mit 52 Jahren. Er hinterliess vier Kinder, über sechzig Alben und mehrere Filme. Kein Musiker hat komponiert wie er, kein Gitarrist so gespielt wie er, kaum ein Bandleader so widersprüchliche Positionen in sich vereint. Frank Zappa war ein Zyniker, der die Musik liebte. Er verachtete das Militär und hasste die Gewerkschaften. Er feierte die sexuelle Befreiung und schrieb sexistische Texte. Er widersetzte sich den Autoritäten und war ein diktatorischer Chef. Er förderte die Improvisation und diktierte Notensätze. Er war kontrollierend und hemmungslos. Er rauchte Kette und fand Drogen idiotisch. Er hatte Humor und war Pessimist. „Das Einzige, was wir immer besser können, ist einander umzubringen“, sagte er. Kein Wunder, dass er Dummheit für ein chemisches Element hielt. Alles, was Zappa machte und dachte, ist bereits in seinem ersten Album „Freak Out“ von 1966 angelegt. Texte und Vortrag sind von einer Ironie durchsetzt, die auch die Hippies und ihre Subkultur nicht verschont. Frank Zappa war, wie er sich selber definierte, ein musizierender Soziologe. Und erkannte früher als die meisten anderen, wie widerstandslos die amerikanische Gegenkultur im Kapitalismus aufgehen sollte.