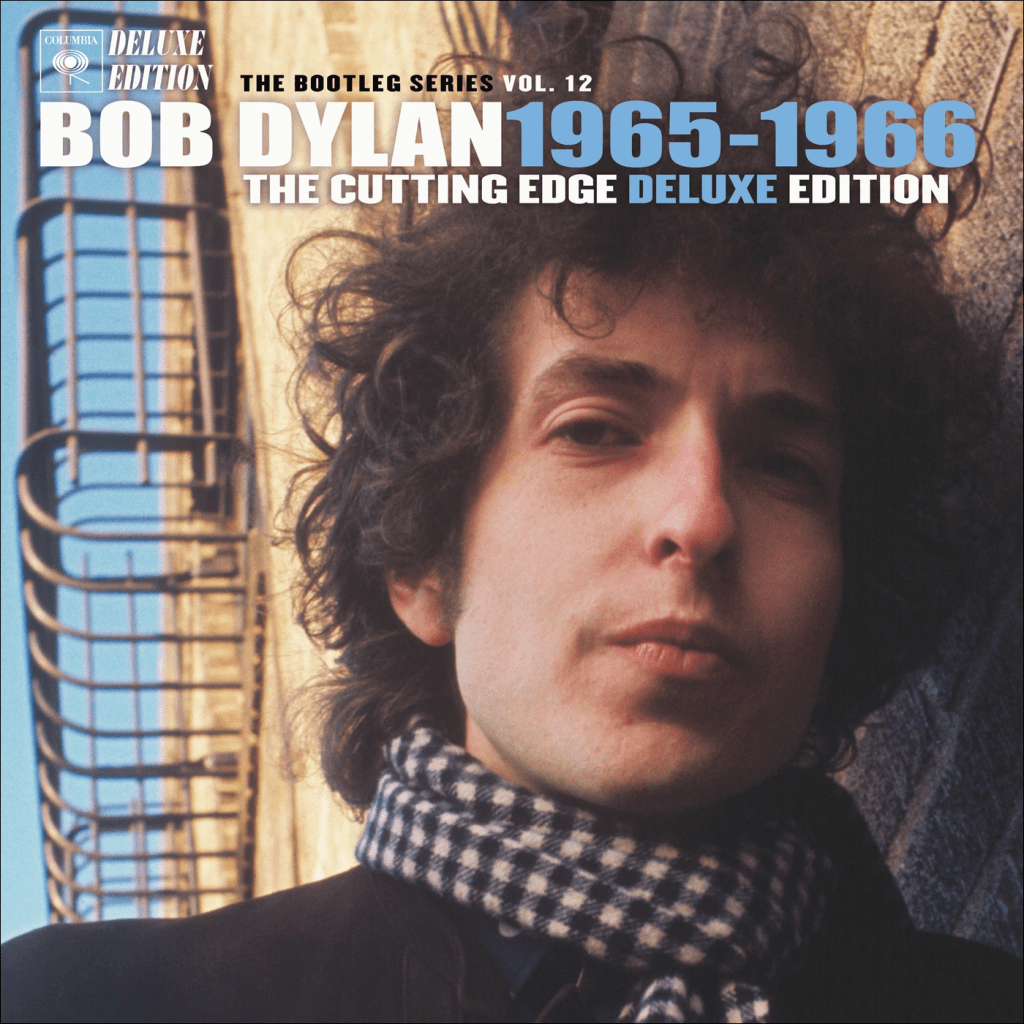The Kinks, Sunny Afternoon, 1966
Text/Musik / Ray Davies
Produzent/ Shel Talmy
Label/ Pye
Wie so viele Songs aus der Zeit zwischen 1966 und 1968 schien „Sunny Afternoon“ den Geist des Wandels zu verkörpern, der damals die USA und Europa durchströmte. „Tune in, turn on, and drop out“, lautete das Motto der Gegenkultur, und immer mehr Menschen begriffen, dass man nicht zum Mainstream gehören musste. Auch die Beatles rieten ihren Fans 1966, sich zu entspannen, die Gedanken auszuschalten und sich flussabwärts treiben zu lassen. Die Kinks jedoch waren vor ihnen da.
Musikalisch und textlich war der Song eine Offenbarung. Der Schritt zurück, den Songwriter Ray Davies damit wagte (zurück in die verrückte Music-Hall-Zeit seiner Jugend), statt die progressive Richtung weiterzuverfolgen, in die die früheren Hits der Band zu weisen schienen, erwies sich im nachhinein als genial. Hinter der warmen, lakonischen Weichheit der Aufnahme verbergen sich kluge Köpfe – eine Beobachtung, die, mal wieder auch auf die Beatles zutrifft, die im Jahr darauf ihre eigene Music-Hall-Hommage, „Being for the Benefit of Mr. Kite“, aufnahmen.