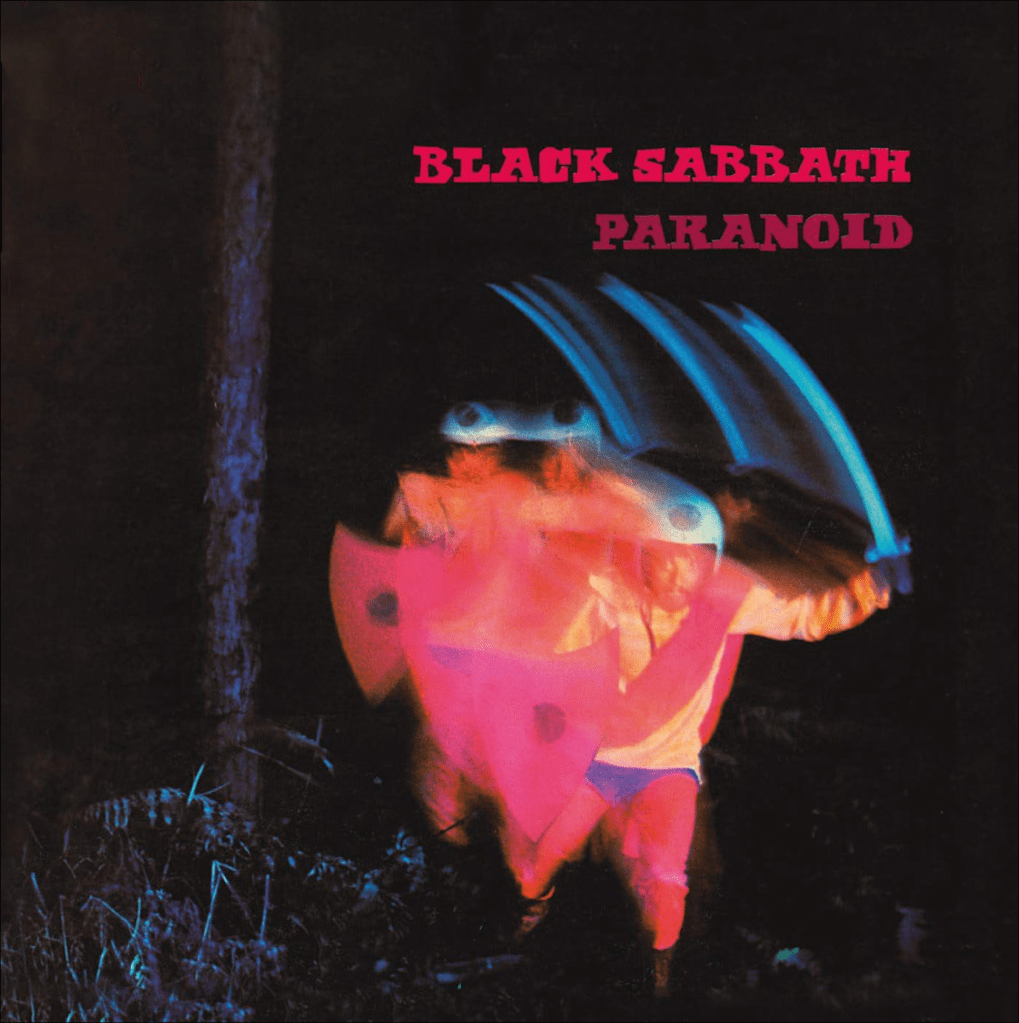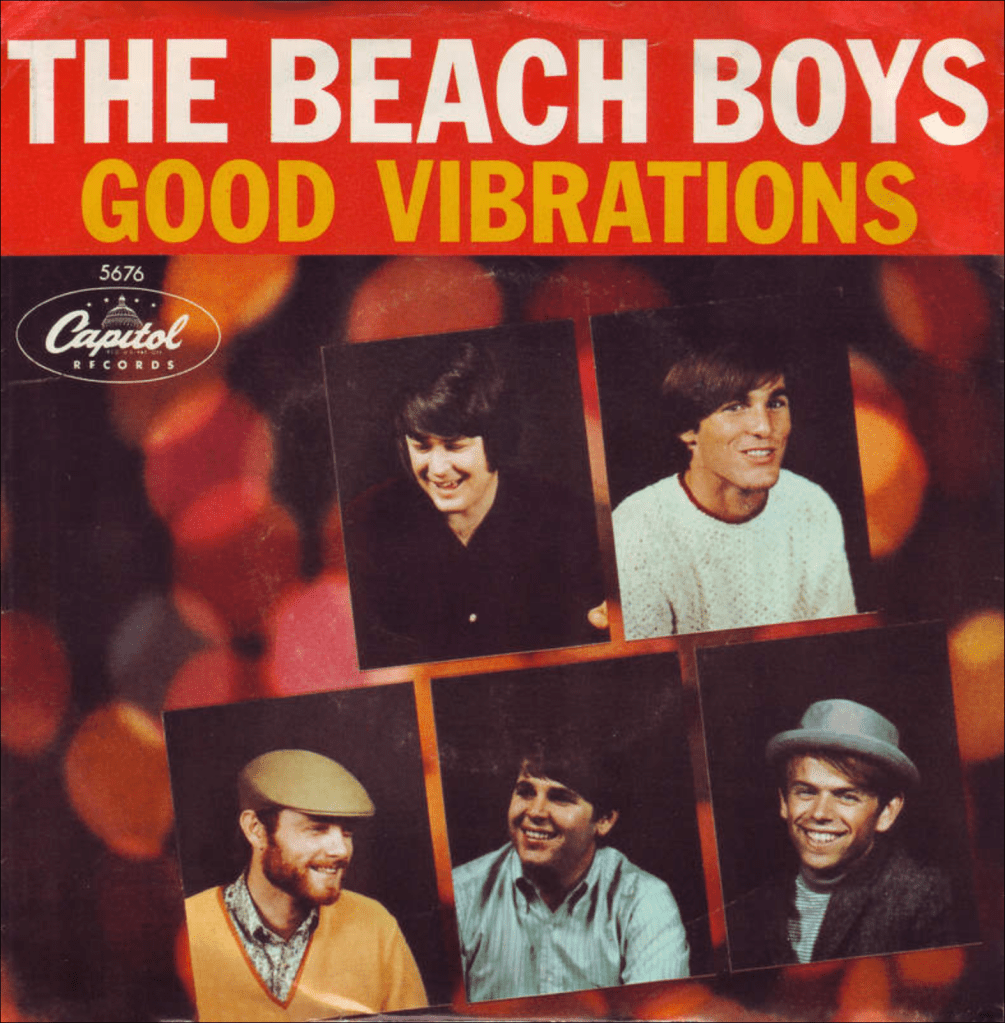Ringo Starr, Look Up, 2025
Produzent/ T-Bone Burnett
Label/ Universal Music Group
Am 7. Juli feiert Ringo Starr seinen 85. Geburtstag. Für ihn noch lange kein Grund, sich aufs Altenteil zu setzen. Was sich nur schon an der Tatsache ablesen lässt, dass der Ex-Beatle in diesem Jahrhundert – je nach Zählweise – bereits neun Studiowerke veröffentlicht hat.
Auf „Look Up“ begnügte er sich für einmal nicht damit, einige launige Tracks mit Promikumpels wie Joe Walsh, Dave Stuart oder Steve Lukather einzuspielen. Die elf Lieder sind vielmehr eine Rückbesinnung auf Ringos alte Stärke: Country. Schliesslich durfte er sich bereits 1965 mit einem Cover von Buck Owens’ „Act Naturally“ beweisen. Produziert von T-Bone Burnett – und natürlich with a little help from his friends wie Larkin Poe oder Alison Krauss – präsentiert Ringo eine ebenso charmante wie altersmilde Liedkollektion. In „I Live For Your Love“ beschwört er die Liebe zu seiner Frau – „til the end of times“, derweil er in „Can You Hear Me Call“ gemeinsam mit Molly Tuttle dem Sound der Appalachen huldigt. Und wie es sich für den Mann aus Liverpool gehört, kommt mit dem anschliessenden „Thankful“ auch ein bisschen Peace & Love vor. Das Resultat ist kein musikalisches Meisterwerk, klingt aber enorm warm, organisch und lebenserfahren.