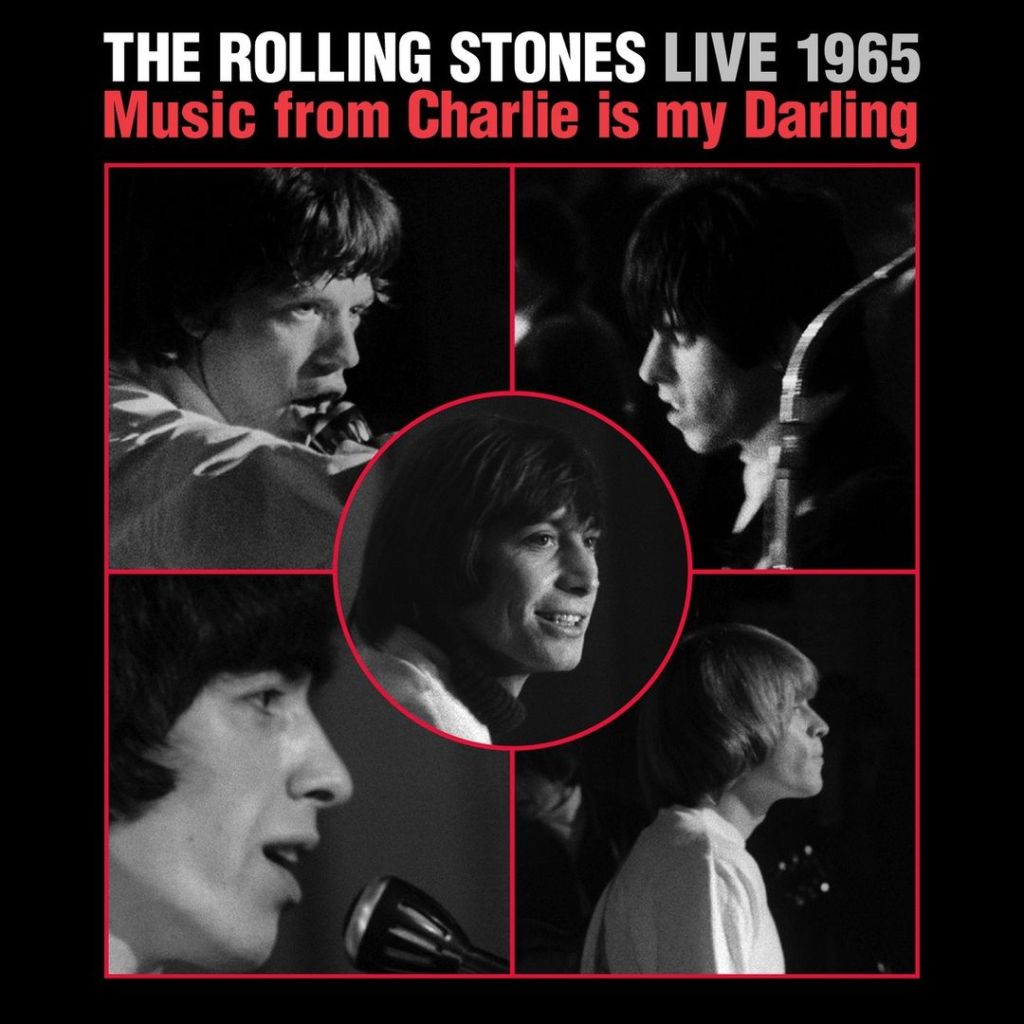The Rolling Stones, Can’t You Hear Me Knocking, 1971
Text/Musik/ Jagger-Richards
Produzent/ Jimmy Miller
Label/ Rolling Stones
Auf „Sticky Fingers“ gibt es zwei markante Saxophon-Soli von Bobby Keys. Das berühmteste in „Brown Sugar“ und das zufällig enstandene in „Can’t You Hear Me Knocking“. Bobby Keys aus Slaton, Texas hatte Ende der 1950er angefangen Saxophon zu spielen und war kurzzeitig sogar in Buddy Hollys Band. Als er 1969 mit den Stones ins Studio ging war schon ein gefragter Begleitmusiker. Den ersten Song „Live With Me“ nahm Bobby wörtlich: Er lebte mit Keith Richards in Südfrankreich, spielte auf „Exile On Main Street“ und war 1972 auf der Stones-Tour dabei. Auf der Europa-Tour 1973 verpasste er einen Gig, da war es mit den Stones erst mal vorbei.
Doch Bobby Keys spielte weiter: Mit Joe Cocker, B.B. King, Eric Clapton, John Lennon und George Harrison, für Charly Simon, Barbara Streisand und sogar für Lynyrd Skynyrd. In den 1980er war er wieder bei den Stones und bei Keith Richards Soloprojekten. Ab „Steel Wheels“ (1989) spielte die texanische Sax-Maschine auf jeder Tour der Stones. Bei der Australien-Tour im Herbst 2014 trat er nicht mehr an. Die bekannte Dreifaltigkeit der Rockmusik hatte ihren Tribut gefordert. Bobby Keys starb an akutem Leberversagen. Sein Sax hämmert noch immer an den Sargdeckel: „Can’t You Hear Me Knocking?“