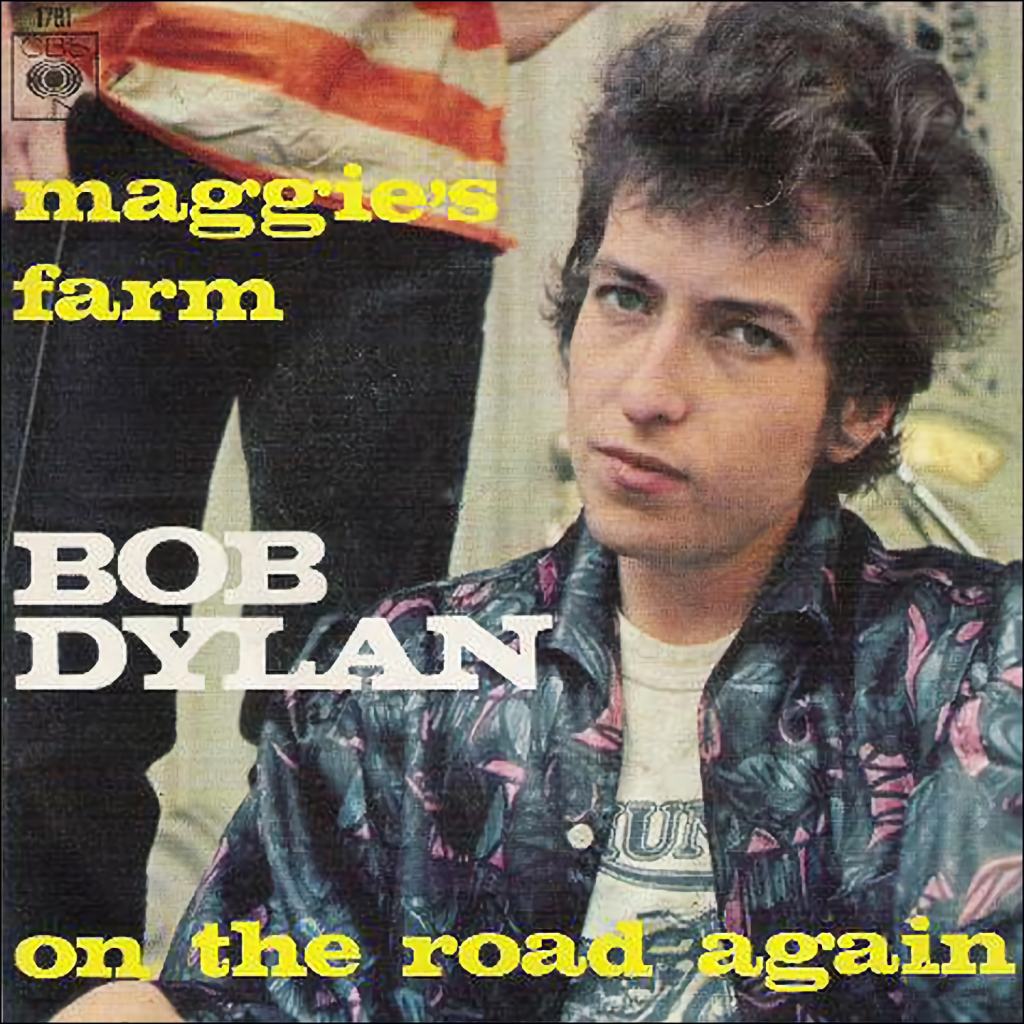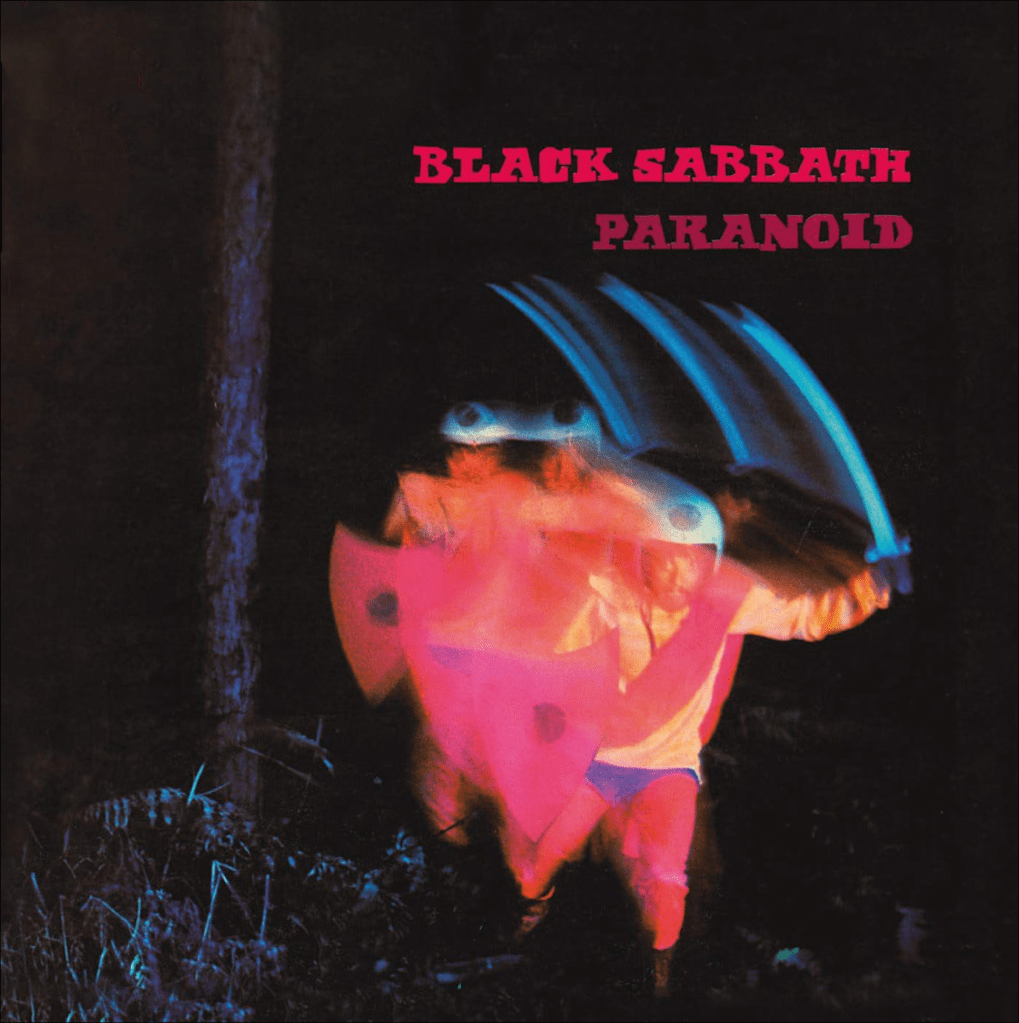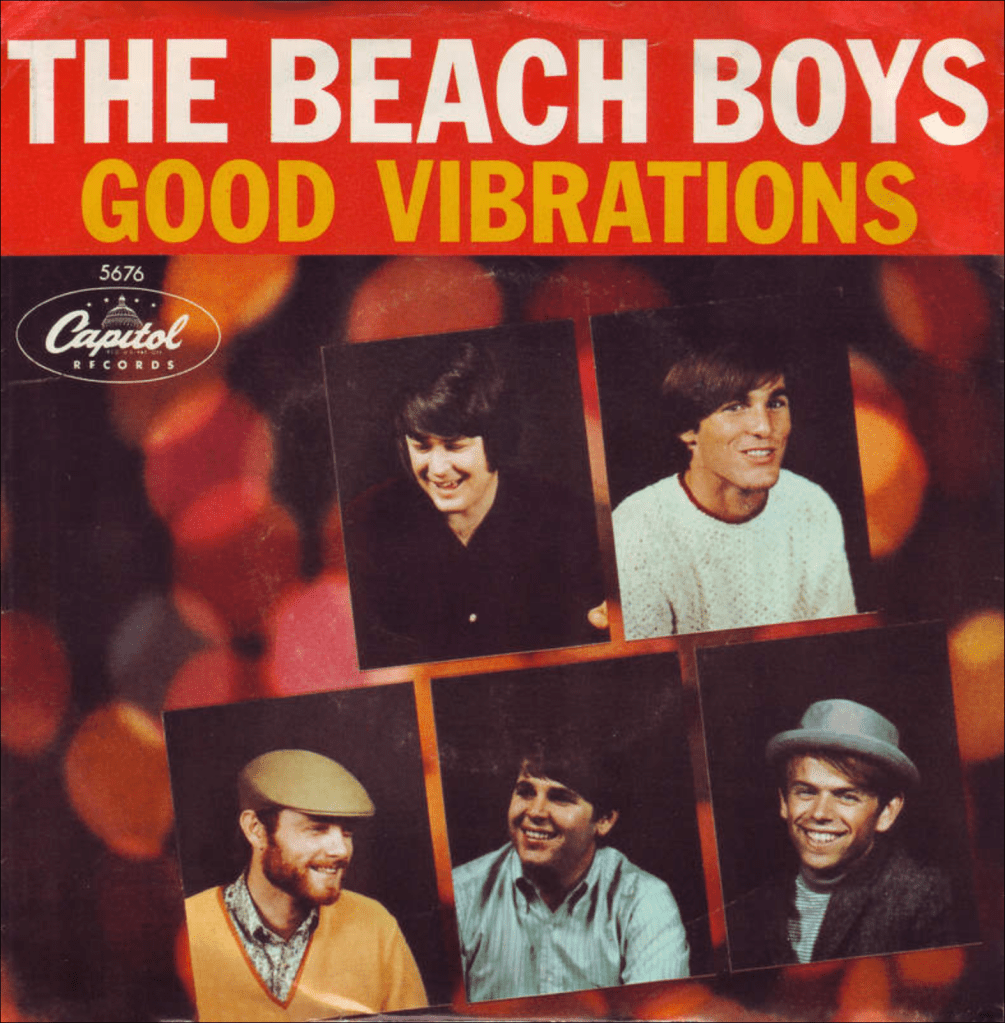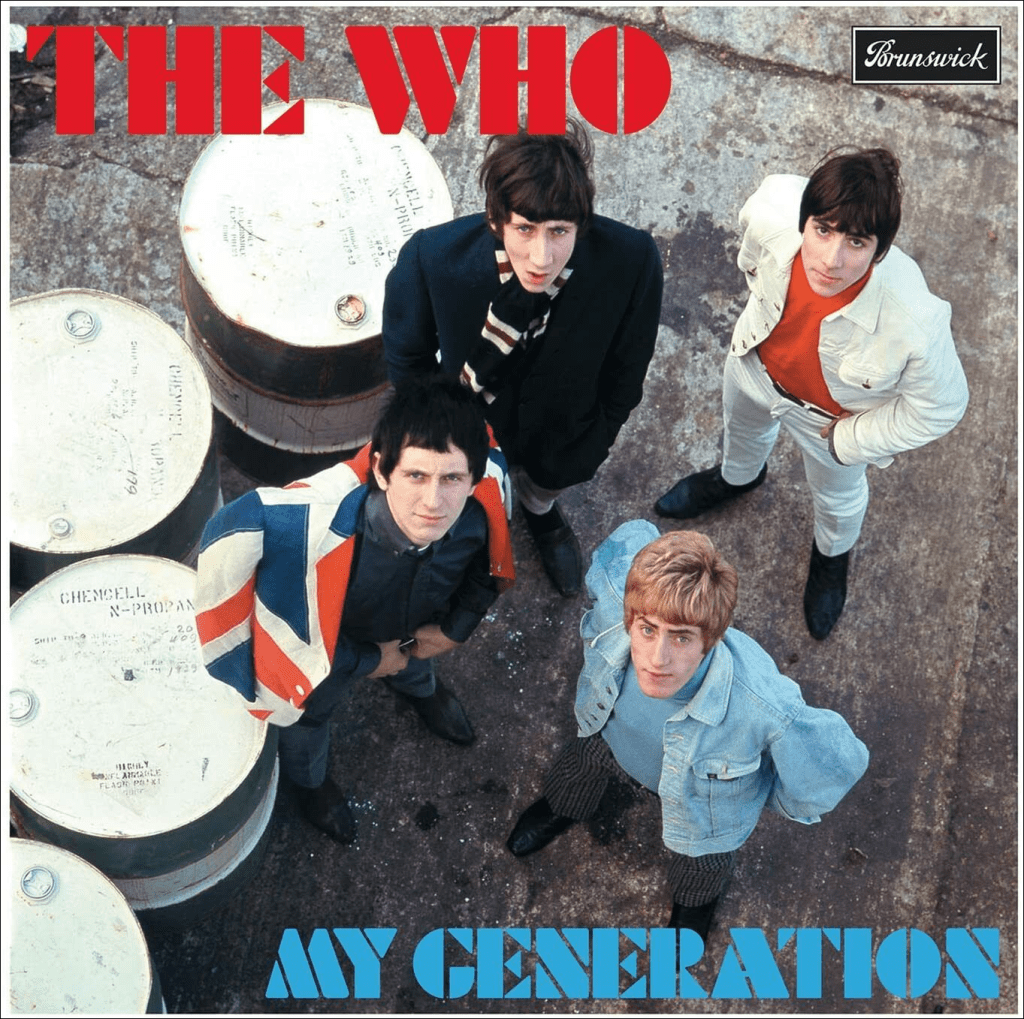The Temptations, Papa Was A Rollin‘ Stone, 1972
Text/Musik/ Norman Whitfield, Barrett Strong
Produzent/ Norman Whitfield
Label/ Gordy
Ohne einen Vater, der sich zumindest ab und zu mal zeigt, natürlich auch kein Konflikt mit dem Sohn oder der Tochter. Der Erzeuger, den die grossartigen Whitfield und Strong in dem Lied „Papa Was A Rolling Stone“ als Herumtreiber beschreiben, hat sich dagegen gleich ganz aus dem Staub gemacht. Erst nach seinem Tod erfährt der Sohn, das der Vater ein rastloser Herumtreiber – wahrscheinlich ein Dieb und Säufer – war, der nie Kohle hatte, dafür aber noch drei weitere aussereheliche Kinder gezeugt haben soll. Auch bei seiner Mutter findet der Sohn keinen Trost – sie kann die Gerüchte nur bestätigen.
Das Stück beginnt mit einer langen instrumentalen Einleitung, ein grossartiges Beispiel des Motown-Sounds auf der Höhe seines Erfolg. Die Gitarre von „Wha Wha“ Watson, die Streicher, die eine melancholische Melodie spielen, und eine Trompete, die über der Hi-Hat-Basstimme zu improvisieren scheint. Und wenn man schliesslich schon nicht mehr daran glaubt, setzt die Baritonstimme von Dennis Edwards ein und nagelt einen am Stuhl fest. Der Song ist reinste Dramaturgie, zugleich aber auch Bericht einer sozialen Tragödie, die Tausende von Jungen und Mädchen tagtäglich erleben: Die Anne E. Casey Foundation, die sich für die Zukunft benachteiligter Kinder in den USA einsetzt, hat 2021 Daten herausgegeben, nach denen fast 70 Prozent der afroamerikanischen Kinder mit nur einem Elternteil leben.