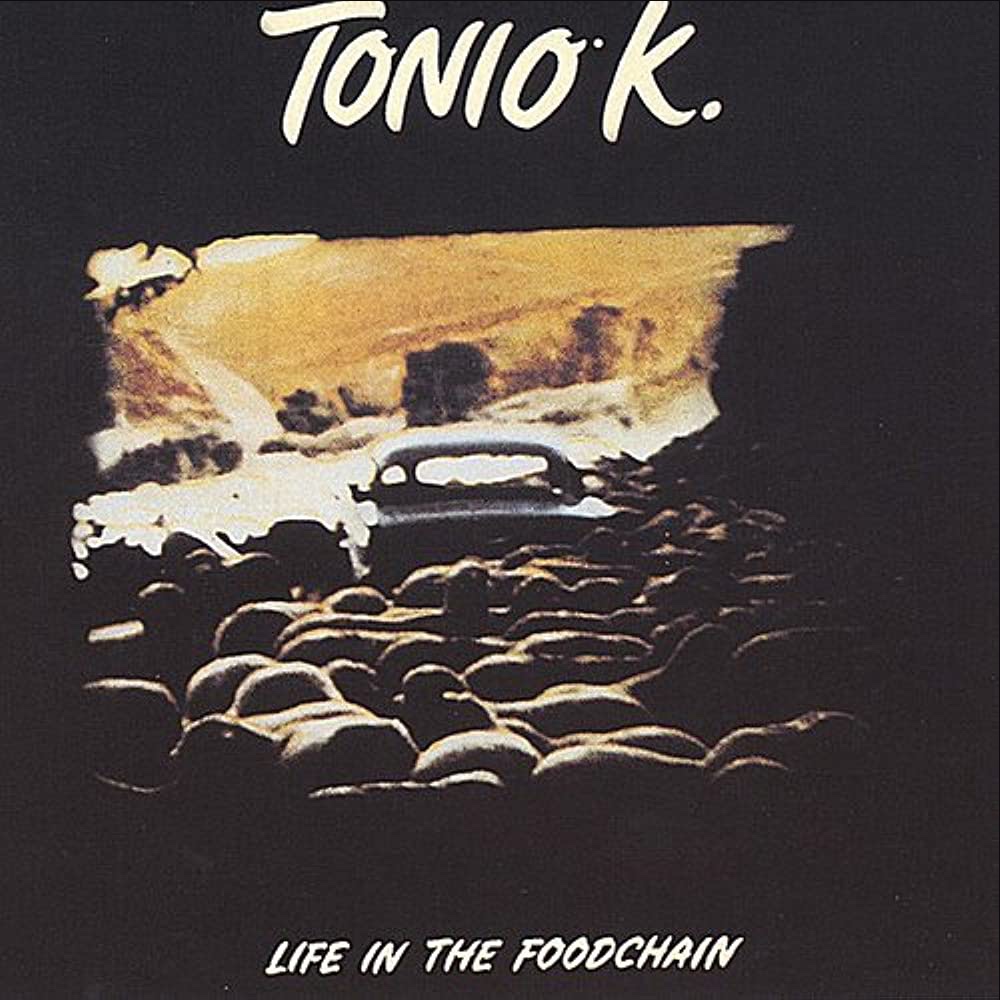The Mekons, So Good It Hurts, 1988
Produzent/ The Mekons, Brian C. Pugsley
Label/ Twin/Tone Records
Die Platte hat den Nachteil, dass Themen wie die Reagan-Thatcher-Connection weit von der Gegenwart entfernt sind und somit leicht verstaubt anmuten. Trotzdem: viele dieser Songs sind fast schon Klassiker und auch in manch anderen Songs gibt es noch einiges zu entdecken. Zum Beispiel die Tatsache, dass Robin Hood und seine Mannen ja eigentlich eine Schwulengang waren oder dass Nixon und Hitler in trauter Verbundenheit einer Satansveranstaltung beiwohnten. Es war eben schon immer die Stärke der Mekons, britischen Humor kunstvoll mit politischem Bewusstsein zu verknüpfen.
Trotz aller Patina gehören alte Mekons Scheiben für mich zu den Platten, die ich immer wieder gerne höre. Vorallem weil die Mekons eine Band sind, die wie es wie keine andere versteht, dass Leben ein Chaos sei, in Songs zu packen. Songs die einem mit Gusto ein anderes Gefühl vermitteln, nämlich das Gefühl, dass auch das Chaos inspirierend wirken kann, selbst dann, wenn man die meiste Zeit damit verbringt, sich über allerhand Ungerechtigkeiten und idiotischen Autofahrer aufzuregen. Und wenn das alles nichts wirkt – so die Mekons – dann gibts ja immer noch Tequila und Country. Item, Sally Timms singt wirklich verdammt schön; sie hat eine dieser britischen Frauenfolkstimmen, die genauso schmeichelnd ist wie sie Unerbittlichkeit und eine gewisse Amüsiertheit über die Weltverbesserungideen der Linken zum Ausdruck bringt.