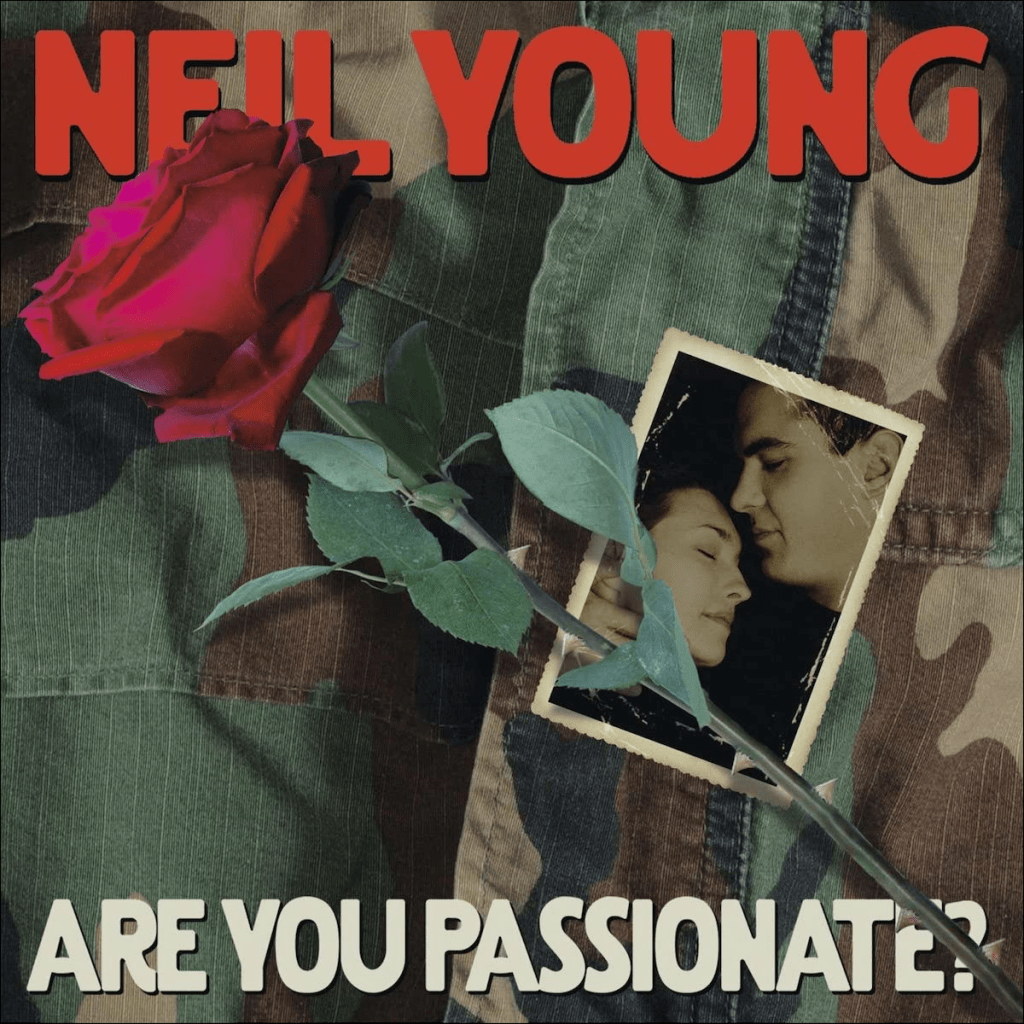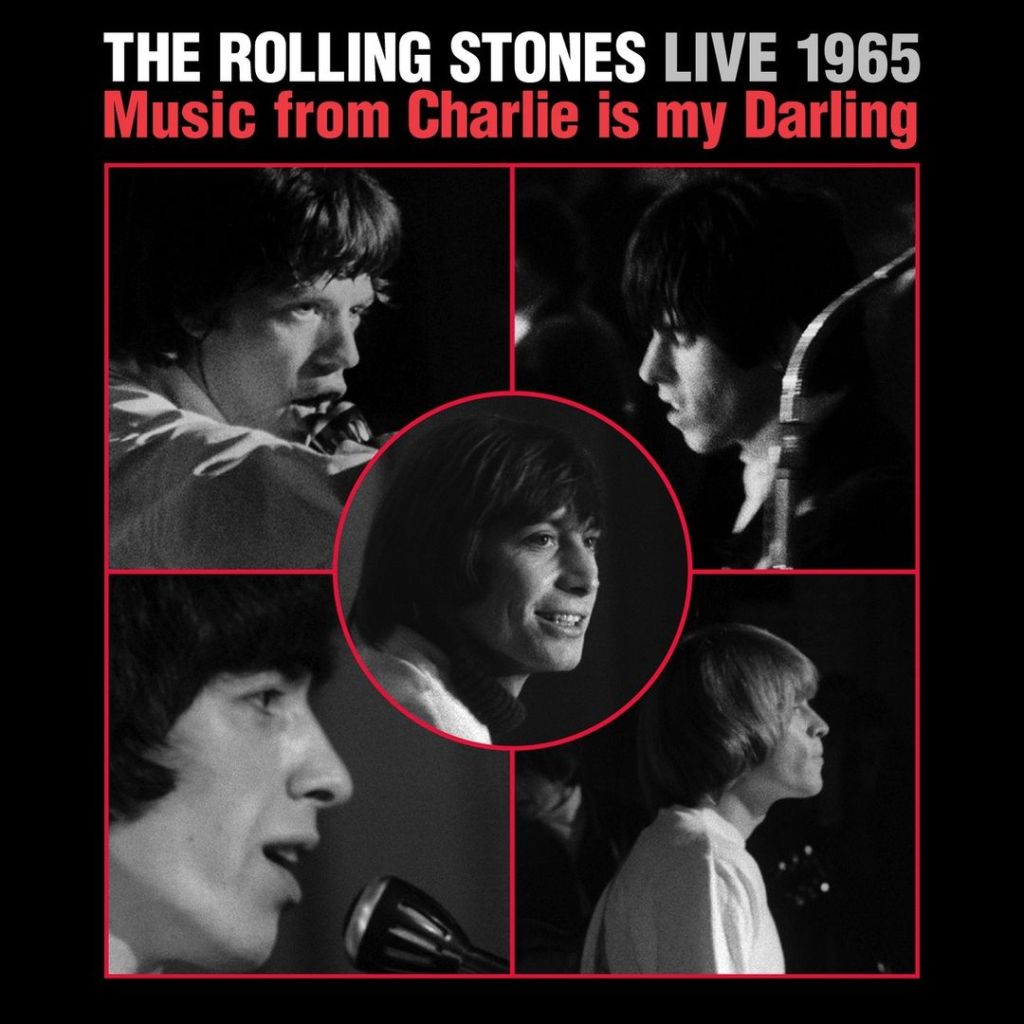Julie Driscoll, Brian Auger & The Trinity, 1970
Produzent/ Giorgio Gomelsky
Label/ Polydor
Julie Driscoll aus London brachte es Ende der 60er Jahre gemeinsam mit Brian Auger und der Trinity zu einigem Weltruhm als extravagante Allroundsängerin mit auffälligen modischen Marotten. Scharen von Fotografen begehrten die Engländerin für Musik- wie Modejournale in ganz Europa abzulichten, und auf der Bühne – gleich, ob im United Kingdom, in den Vereinigten Staaten, Frankreich oder Deutschland – verausgabte sie sich bei intensiven Darbietungen. Lange hielt Driscoll den Rummel um ihre Person nicht aus. Bereits 1971 sagte sie der kommerziellen Pop-Szene Lebewohl. Danach widmete sie sich, als Julie Tippett mit ihrem Mann Keith Tippett, dem Ensemblegeist verpflichtet, sowohl avantgardistischen als auch pädagogischen Musik-Projekten.
Dieses Album vereint eine Auswahl von Liedern ihrer Singles sowie ihrer beiden LP’s „Streetnoise“ und „Open“, die sie zusammen mit Brian Auger aufgenommen hat (1967-1968). Alle Nummern sind grossartig und dokumentieren den Übergang der puren Lebenslust der Hippiezeit zur artifiziellen Selbstinszinierung. Alle Hits von Julie Driscoll und Brian Auger sind hier zu finden, ebenso kongeniale LP-Tracks.
Die etwas zickige Hammond-Orgel von Brian Auger mag einem heute gelegentlich auf die Nerven gehen. Aber Julies Stimme ist geschmeidig, stilistisch elegant, nuanciert und eindringlich; intim und verletzlich pendelt sie zwischen Soul, Blues und Jazz. Schon allein die Coverversionen von „Wheels Of Fire“ und „Season Of The Witch“ bewiesen damals, dass sie wohl die einzige britische, weisse Sängerin war, die die Fähigkeit besass, Soul und Blues zu singen, wie er eben auch klingen muss. Höchst authentisch!