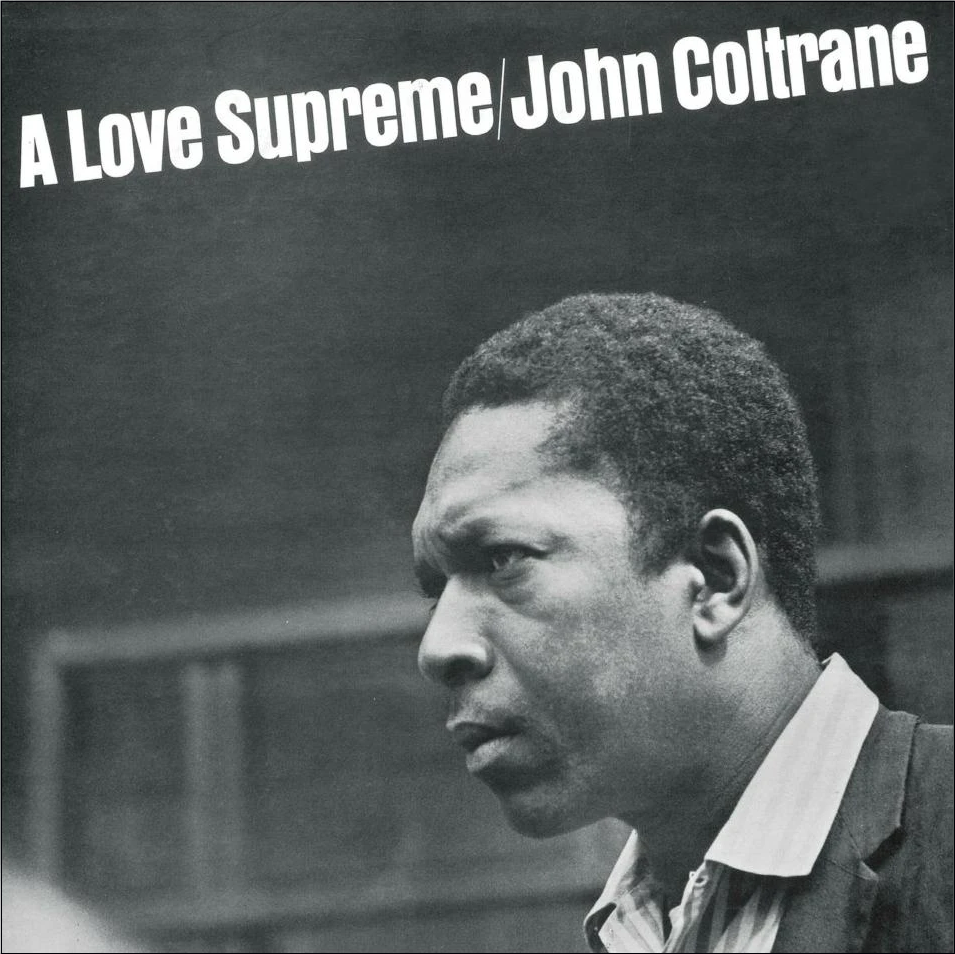XTC, Dear God, 1986
Text/ Musik/ Andy Partridge
Produzent/ Todd Rundgren
Label/ Virgin Records
In dem Song „Dear God“ schreibt jemand einen Brief an den lieben Gott, nur um ihm mitzuteilen: „I don’t believe in you“. In dem Paradox, jemanden persönlich zu adressieren, von dem man annimmt, dass es ihn gar nicht gibt, spiegelt sich ein anderes häufig formuliertes Paradox wider: die scheinbare Unvereinbarkeit der Existenz Gottes mit all den schlimmen Dingen, die auf der Welt geschehen. Wenn es einen Gott gibt, so der bekannte grundsätzliche Gedankengang, wie kann er all die Kriege, Verbrechen, Grausamkeiten, Unglücke und Naturkatastrophen zulassen, durch die seit ewigen Zeiten unzählige Menschen schuldlos sterben und leiden?
Die erste Strophe wie auch der Schluss des Songs werden von einem Kind gesungen. Erst mit der zweiten Strophe setzt XTC-Sänger Andy Partridge ein. Mit dem Einsatz der Erwachsenenstimme wird auch der Ton des Briefes schärfer: „Lieber Gott, sorry wenn ich störe, aber wenn ich all die Menschen sehe, die sich wegen Dir bekriegen, dann kann ich nicht an Dich glauben. Auf einen Zwischenteil mit erneut in Richtung Paradox zielenden Fragen wie „Hast Du die Menschheit geschaffen, nachdem wir Dich geschaffen haben?“ („Did you make mankind after we made you?“) folgt eine weitere Strophe, in der es um die Bibel geht. Gott sei darin recht häufig erwähnt, er solle sich das Buch mal genauer anschauen. Geschrieben worden sei es von uns verrückten Menschen, die Gott nach seinem Ebenbild geschaffen habe und die tatsächlich glaubten, der „ganze Mist“ („that junk“) sei wahr.