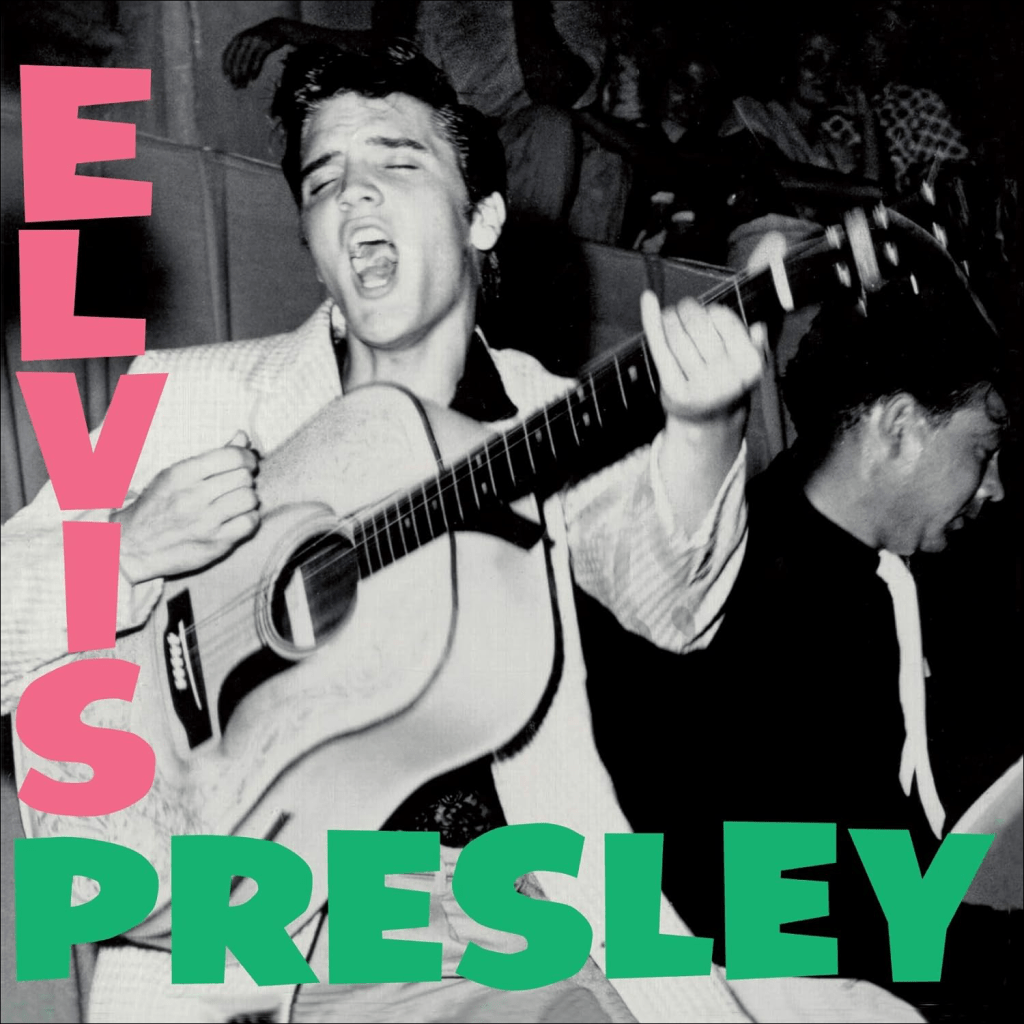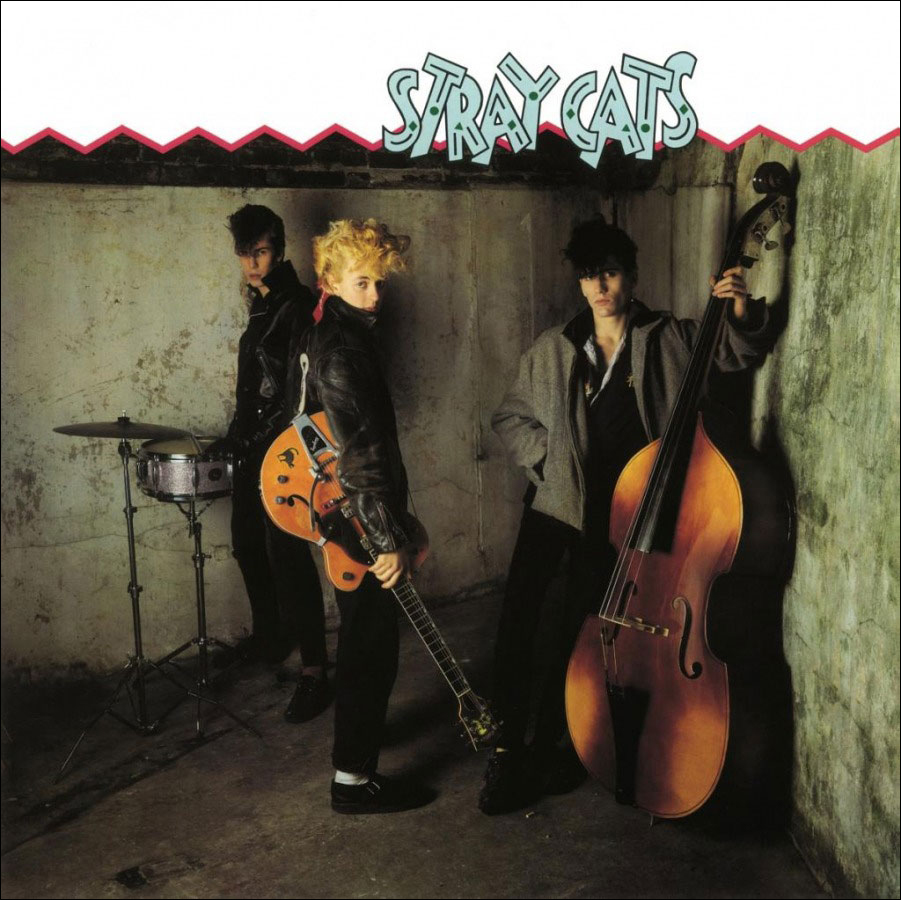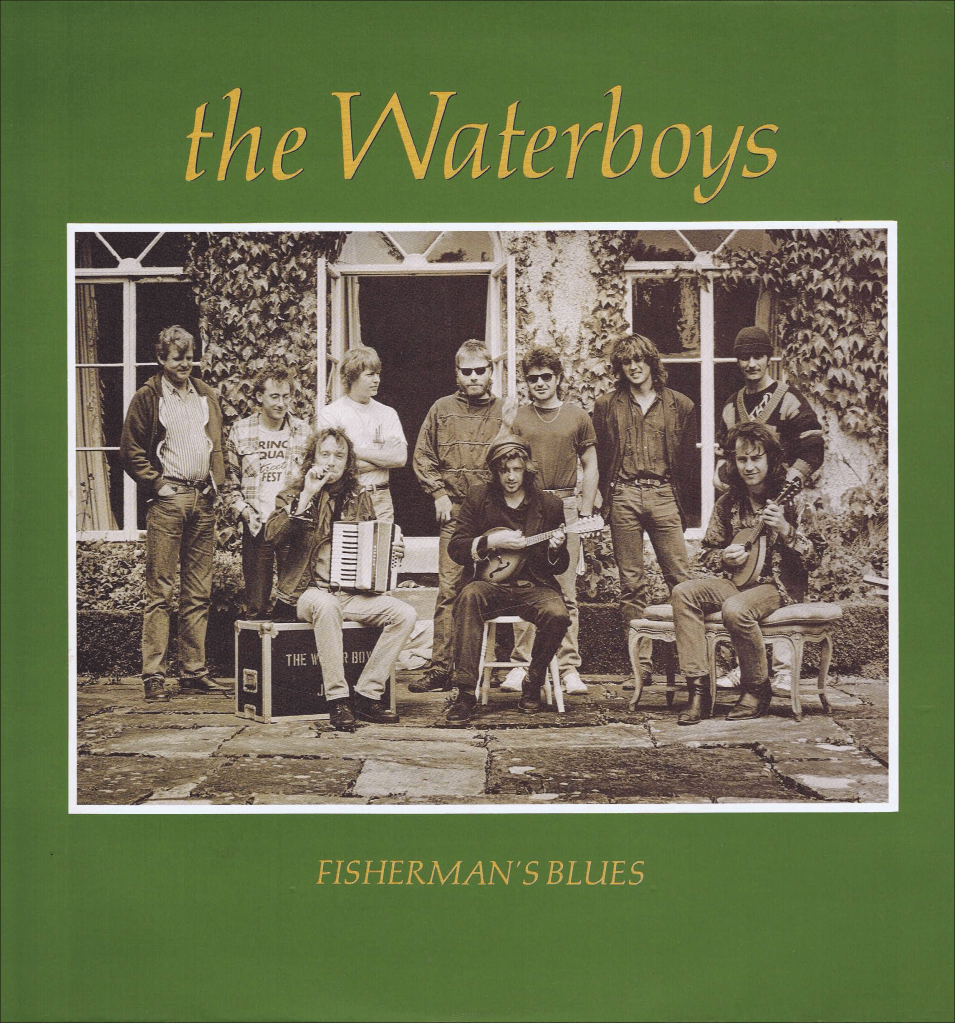Uncle Tupelo, No Depression, 1990
Produzent/ Sean Slade, Paul Q. Kolderie
Label/ Columbia Records
Uncle Tupelo waren eine verlässliche Grösse im entstehenden Americana-Genre der frühen Neunziger, Stichwort: Flanellhemd. Ihr Debütalbum „No Depression“, hatte in unnachahmlicher Weise Post Punk und Alternative Rock mit Country und Folk verbunden. Der Titel des Albums war dem gleichnamigen Song der Carter Family aus den 1930er Jahren entlehnt, den die beiden Songwriter der Band, Jay Farrar und Jeff Tweedy, zu einem musikalischen Meilenstein der Grunge-Ära umdeuteten.
Die Themen von „No Depression“ sind vorallem klassische Motive, die das Dasein in einer amerikanischen Kleinstadt, den Traum von Weggehen und die Angst vorm Ankommen berühren. Der Erfolg des Albums verdeutlichte, dass selbst die Generation Punk dem Sentiment des Country erliegen konnte, wenn dieser authentisch klang und nicht als reaktionäre Nashville-Mogelpackung daherkam.
1994 war es dann mit Uncle Tupelo vorbei, das finale Album „Anodyne“ wurde in Austin, Texas aufgenommen und enthielt auch ein Duett mit Doug Sahm. Zwischen 1995 und 2008 erschien „No Depression“ als gedruckte Musikzeitschrift, heute erscheint sie weiter als social-media-intensive Website. Auch Farrar und Tweedy machten mit ihren eigenen Folgebands weiter, insbesondere Tweedys Doppelalbum „Being There“ mit Wilco gilt als „White Album des frühen Americana.