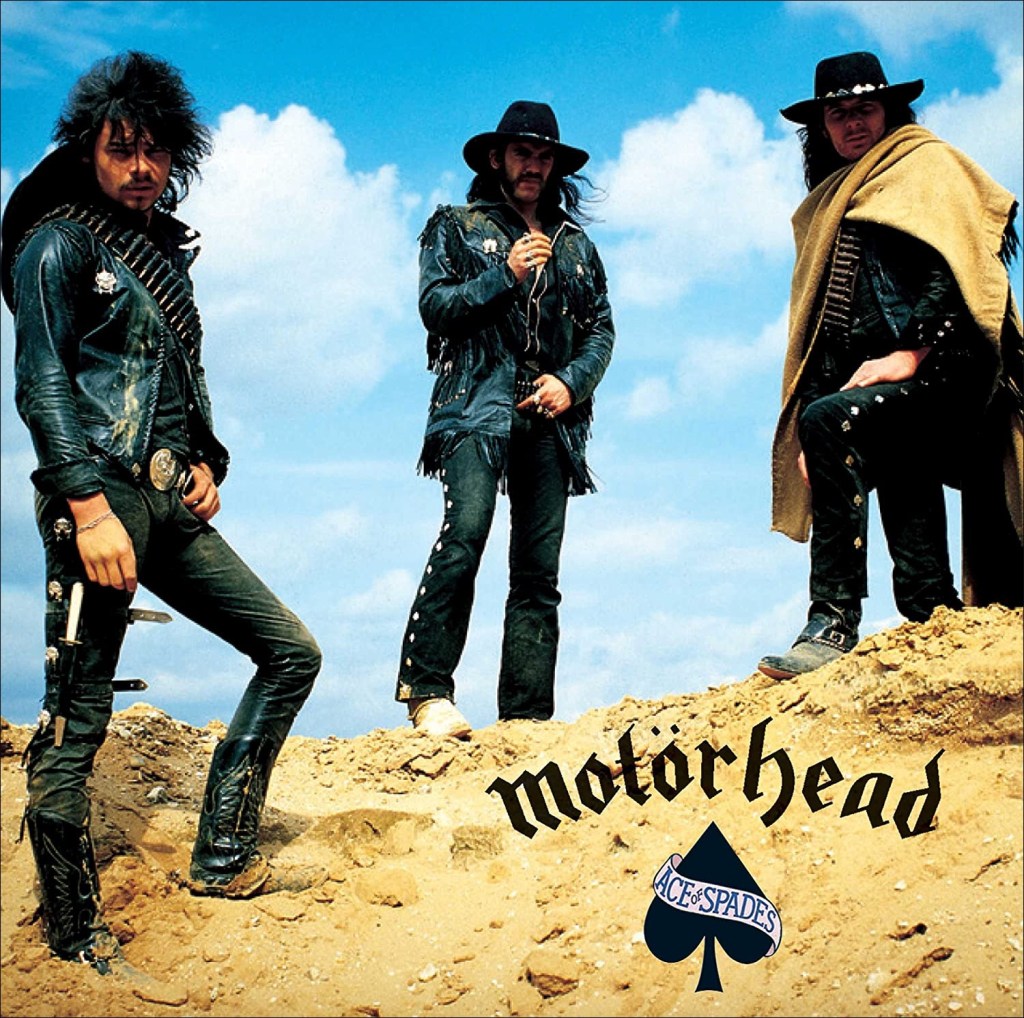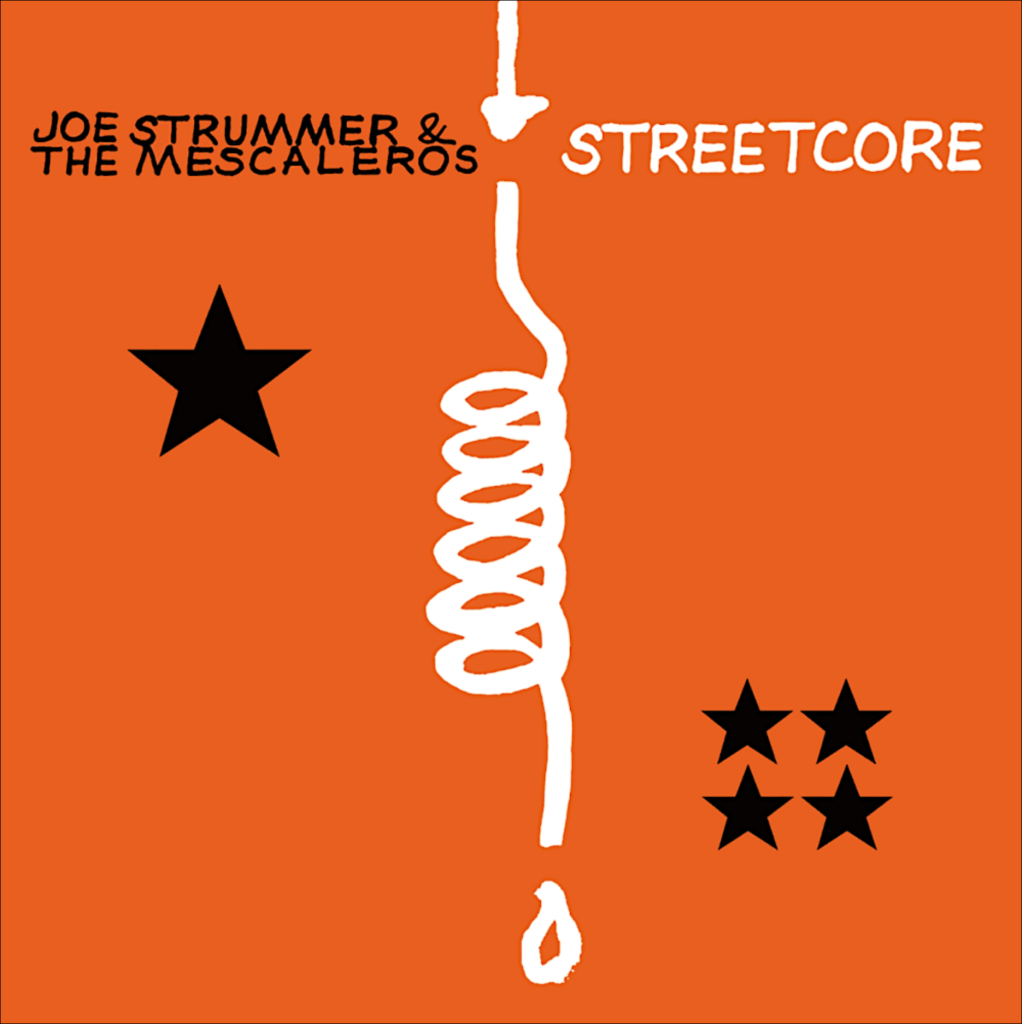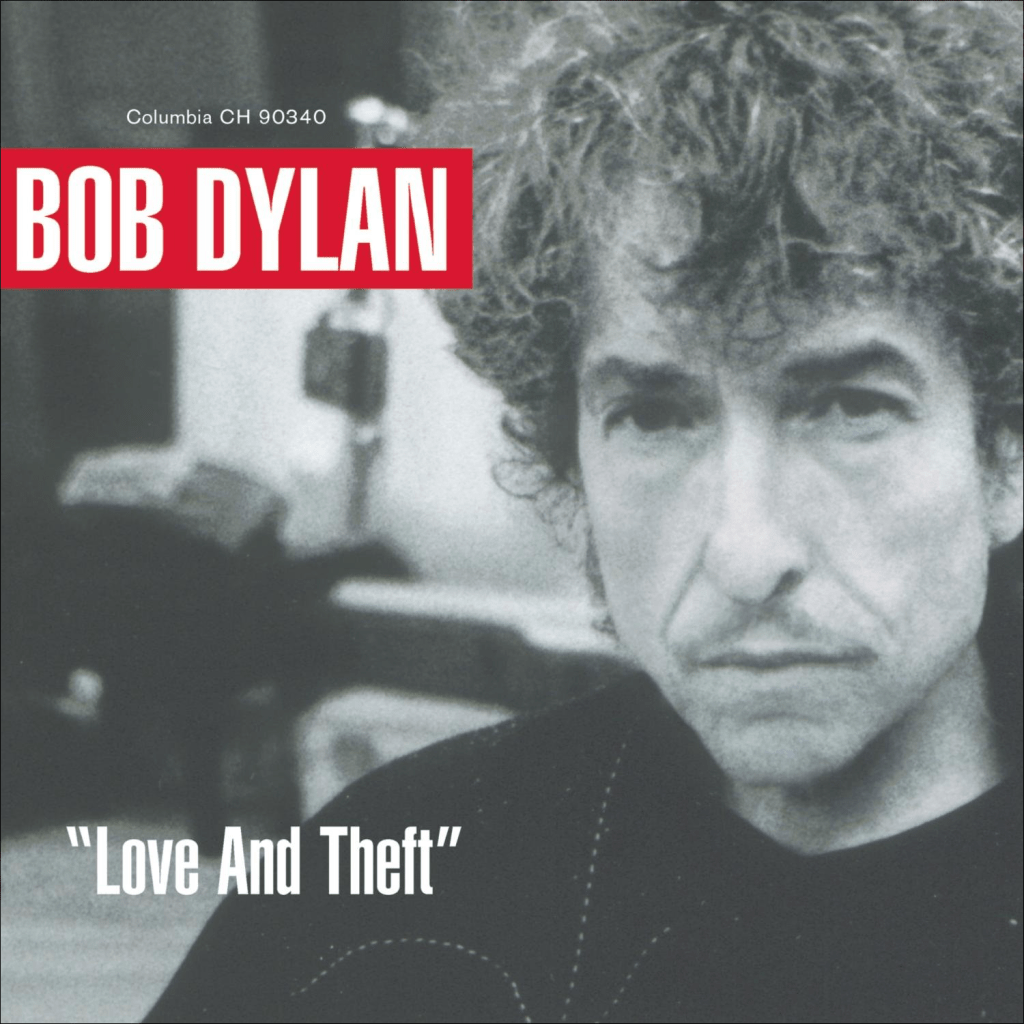ZZ Top, Jesus Just Left Chicago, 1973
Text/Musik/ Billy Gibson, Dusty Hill, Frank Beard
Produzent/ Billy Ham
Label/ London Records
Die Stimme klingt, als habe man ihren Besitzer in aller Frühe aus dem Bett geholt: „Jesus just left Chicago/ And he’s bound for New Orleans./ Jesus just left Chicago/ And he’s bound for New Orleans.“ Gerade die Wiederholung lässt den Verdacht aufkommen, dass es die Aufgabe dieses Mannes war, Jesus nicht aus den Augen zu lassen und dafür zu sorgen, dass Jesus Chicago nicht verlassen konnte; aber er hat versagt. Es kam zu einem Wortwechsel, dann hat Jesus sich aus dem Staub gemacht und ist jetzt vermutlich unterwegs nach New Orleans.
Man erwartet nun eine Personenbeschreibung des Flüchtigen, aber was kommt ist ein kodierter Bericht: „Working from one end to the other/ And all points in between.“ Wenn es hier nicht um einen flüchtigen Erlöser ginge, sondern um einen von zu Hause weggelaufenen Teenager gleichen Namens, dann könnte man vielleicht noch davon ausgehen, dass dieser Satz triviale Bedeutung hat. Scheinbar trivial, denn dieses „Dazwischen“ wird nicht nur durch den Anfangs- und den Endpunkt bestimmt, sondern vorallem durch den Weg, denn jemand zurücklegt, um von A nach B zu kommen – und der kann über den ganzen Globus führen und ein ganzes Menschenleben lang dauern, oder – wie in diesem Fall – alle Menschenleben zusammen. Ausserdem wäre Jesus nicht der erste, der im Irrgarten des „Dazwischen“ verschwunden ist.