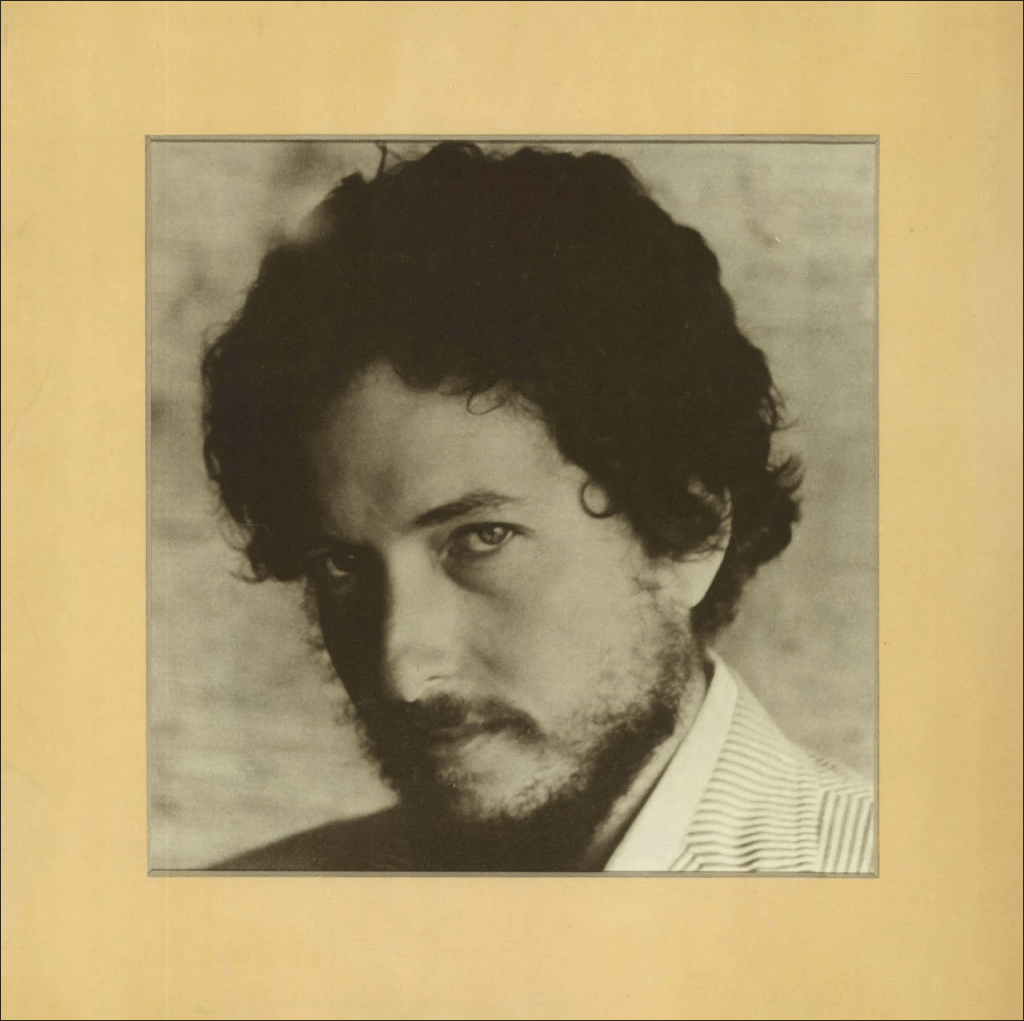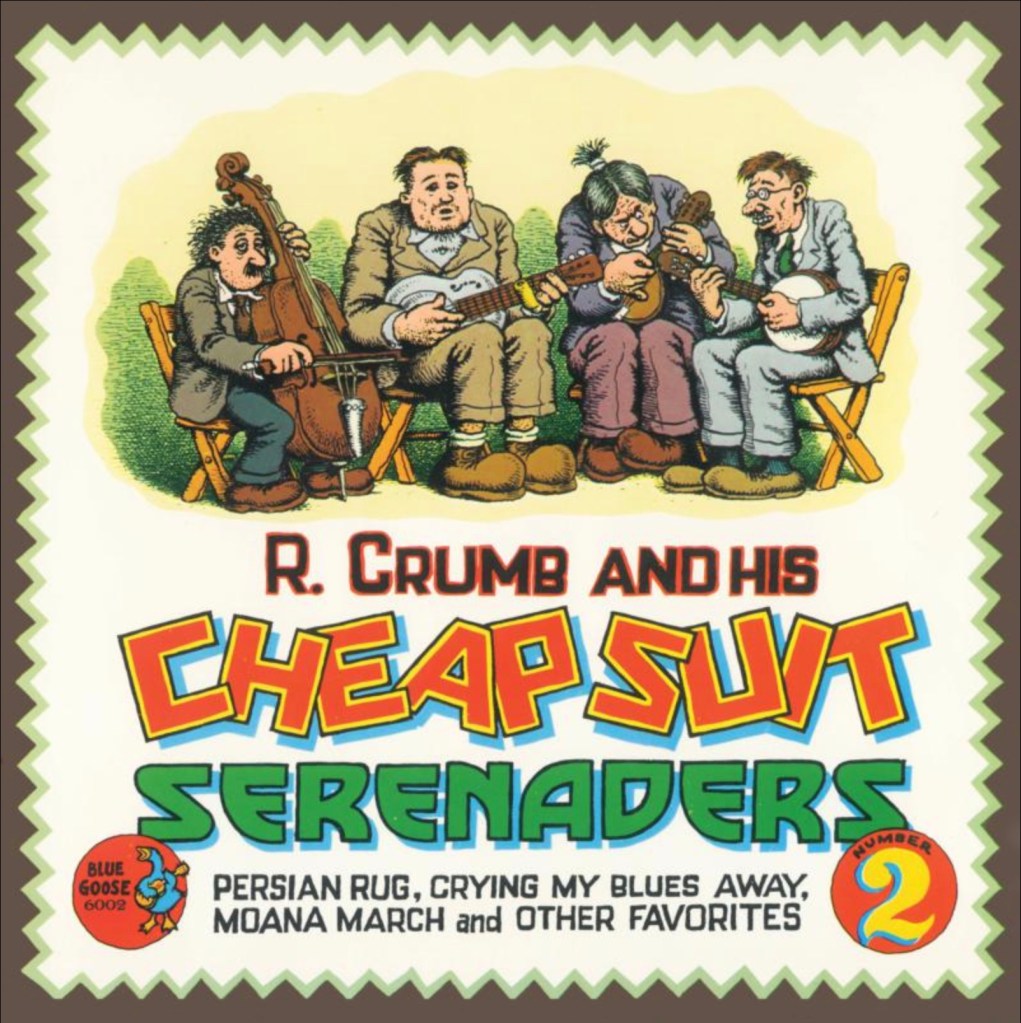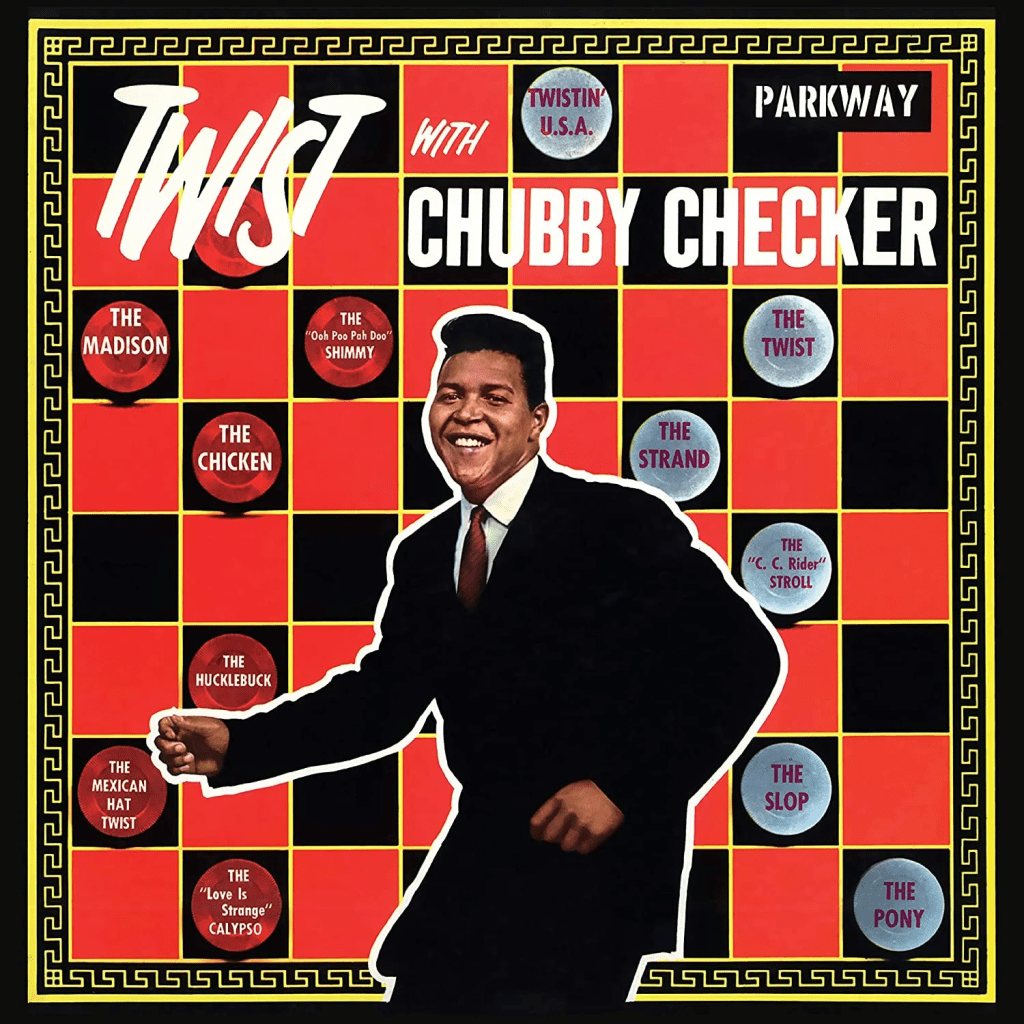Talking Heads, True Stories, 1986
Produzent/ Talking Heads
Label/ Sire
Natürlich kann es noch schlimmer kommen, denn das hier ist nicht nur grossartig, sondern auch noch wahr. Getreulich aufgezeichnet von einer Band, die ehemals als zu kopflastig verrufen war, die jeden Menschen zum Studenten machte, auch wenn er kein Abitur hatte. Abends in der Kneipe wurde dann wieder diskutiert, was dieses Stück sei, das sei eigentlich auch nicht schlecht. Und die neuste von den Talking Heads, habe irgendwie meiner Meinung nach auch wieder den Glanz eines Meisterwerks.
In leicht fasslicher Form gibt es auf „True Stories“ eine Abrechnung mit der grausige Welt der US-Kleinbürger. „True Stories“ ist aber nicht nur eine Platte, sondern auch gleichzeitig ein Film. Eine skurrile Momentaufnahme eines kleines Städtchens mitten in Texas voller seltsamer Typen, die in ihrer jeweils eigenen Welt leben und sich durch den Alltag einer Kleinstadt quälen. Subtiler und feiner Humor, eingepackt mit den Songs und reizvoll kontrastierend mit patzigen Dirty-Bubblegum-Pictures. Alles ein bisschen schmierig. In den Videos, bei denen einen das Grausen anfliegt, kommt David Byrne als Bandmitglied immer noch am Besten raus. Das aber dieser eingeschlagene Weg nicht der richtige war, zeigte sich bereits zwei Jahre später mit dem letzten Album der Band. „Naked“ ist eine grandiose Rückkehr zum besten Album „Remain in Light“.