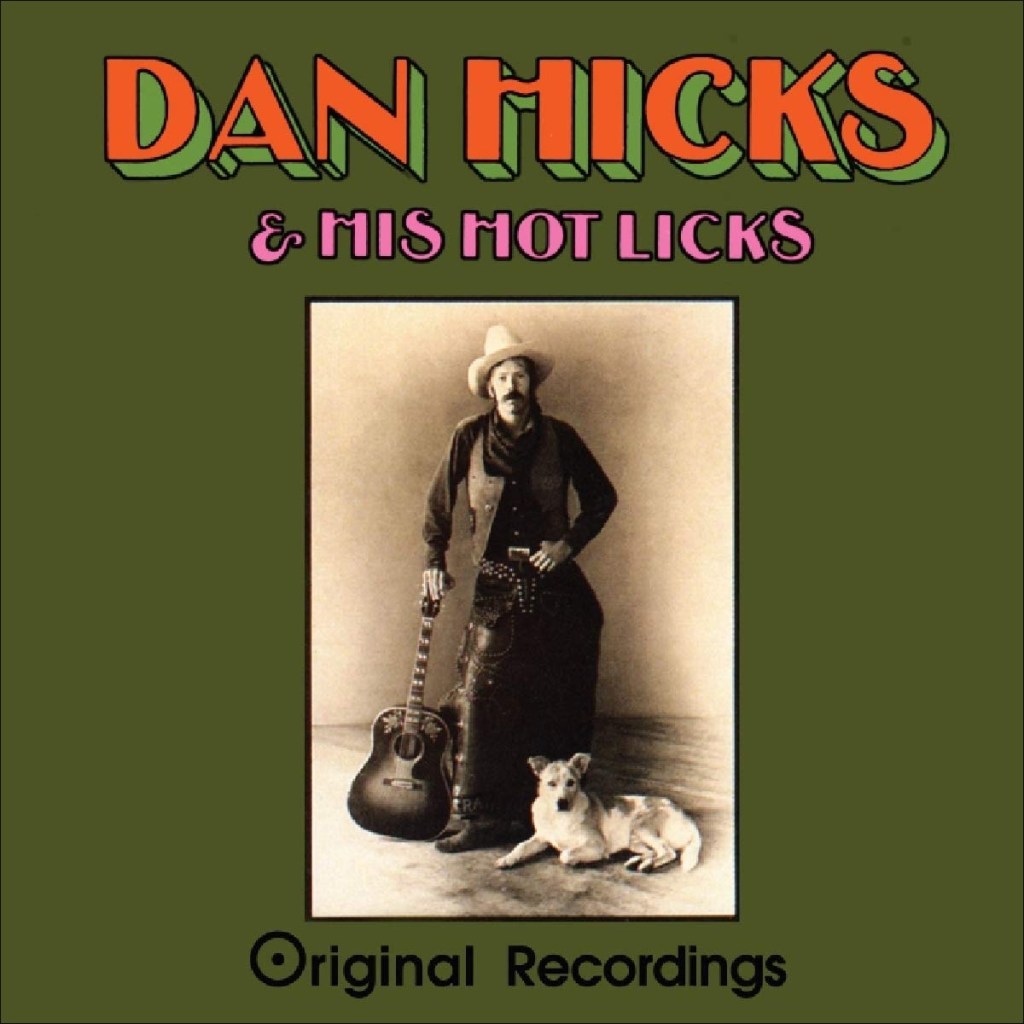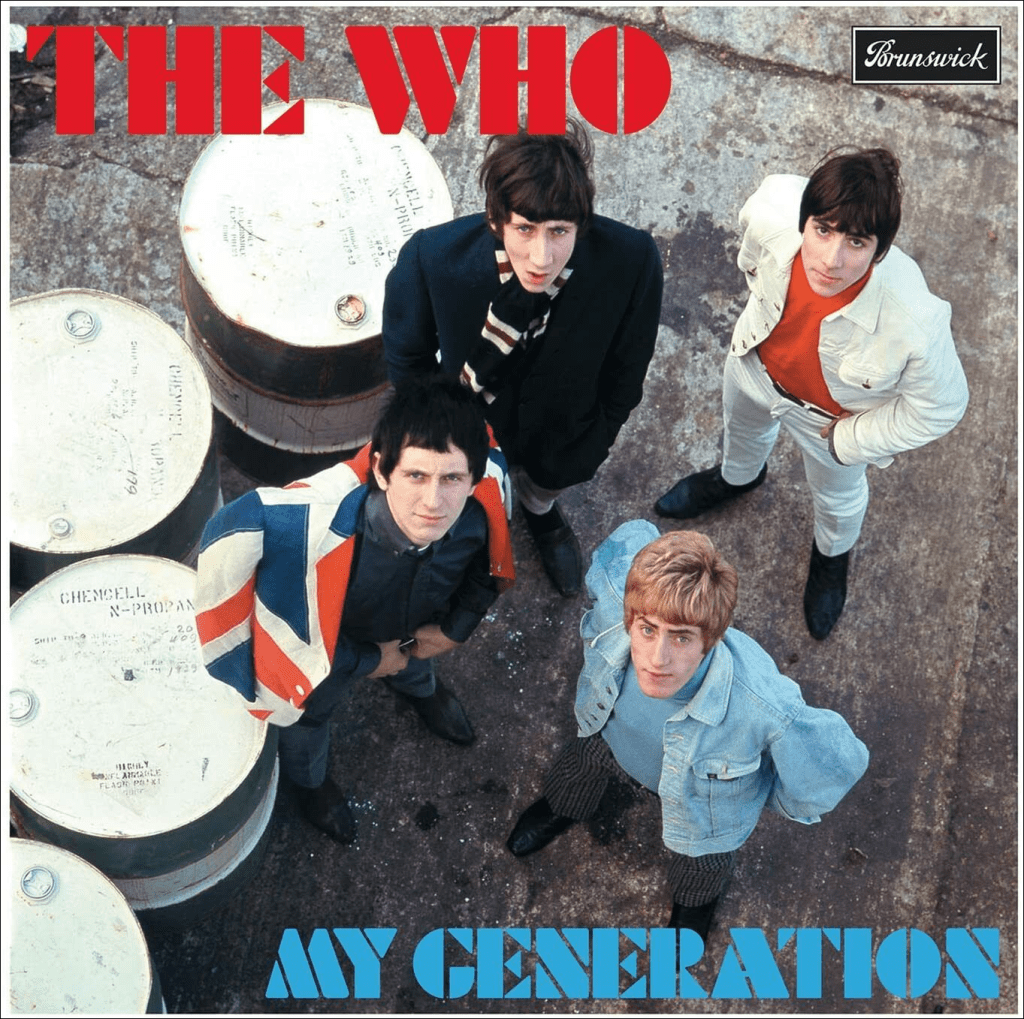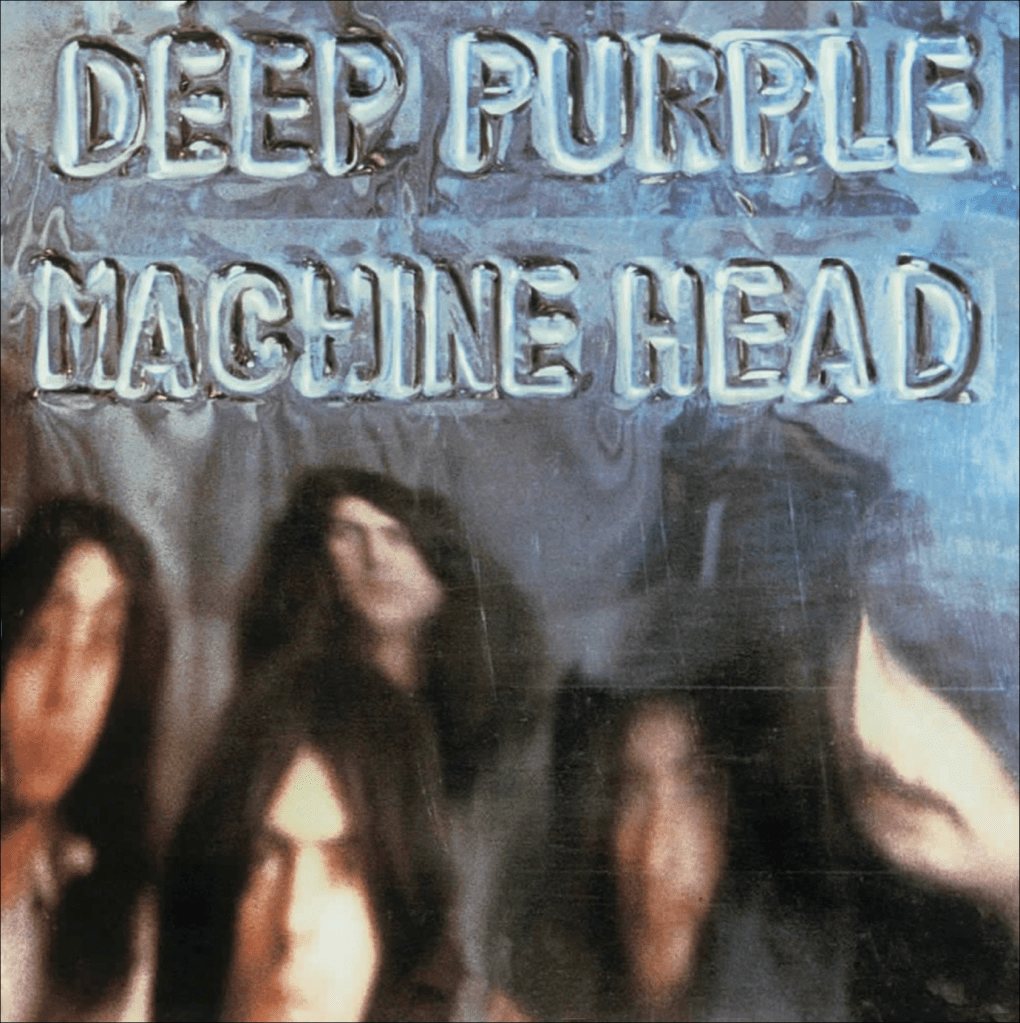Ry Cooder, Chicken Skin Music, 1976
Produzent/ Ry Cooder
Label/ Reprise Records
Chicken Skin ist ein Begriff aus dem Hawaiianischen, der für „Gänsehaut“ steht. Und „Gänsehautmusik“ ist dort das grösste Kompliment für einen Sound, der gut ankommt. Ry Cooder hat sich hier – im Gegensatz zu seinen früheren Solo-Alben – nicht nur an amerikanische Blues-, Gospel- und Folk-Vorlagen gehalten. Hinzugekommen ist obendrein traditionelle Hawaiianische Musik und ein guter Schuss mexikanischer Mariachi-Klänge, gespielt von dem mexikanisch-texanischen Akkordeonisten Flaco Jiminez.
Die Mischung klingt für Hard Rock- und Techno geschädigte Ohren recht befremdlich, ist aber entspannt und warm-sympathisch, so eigenartig und klar, dass das Anhören eine wahre Wohltat ist. Cooder’s Aufbereitung der alten Leadbelly Stücke „The Bourgeois Blues“ und „Good Night Irene“ ist meisterhaft und gehört zu den schönsten Versionen, die ich kenne. Auch als Bottleneck-Gitarrist ist Cooder für mich unübertroffen, und jedes seiner Stücke trägt seinen unverkennbaren Stempel. Mit seiner ungewöhnlichen Synthese von Gospel, Folk, Blues, hawaiianischer- und mexikanischer Folklore demonstriert Ry Cooder die Modernität oder besser gesagt die Zeitlosigkeit aller unverbildeten Empfindung für „archaisches“ oder als „primitiv“ verpöntes Musizieren. Obwohl er dabei auf spektakuläre Effekte verzichtet und nichts als aufrichtige Musik macht, ist der Titel des Albums berechtigt. Aber was erzeugt denn heute noch Gänsehaut?