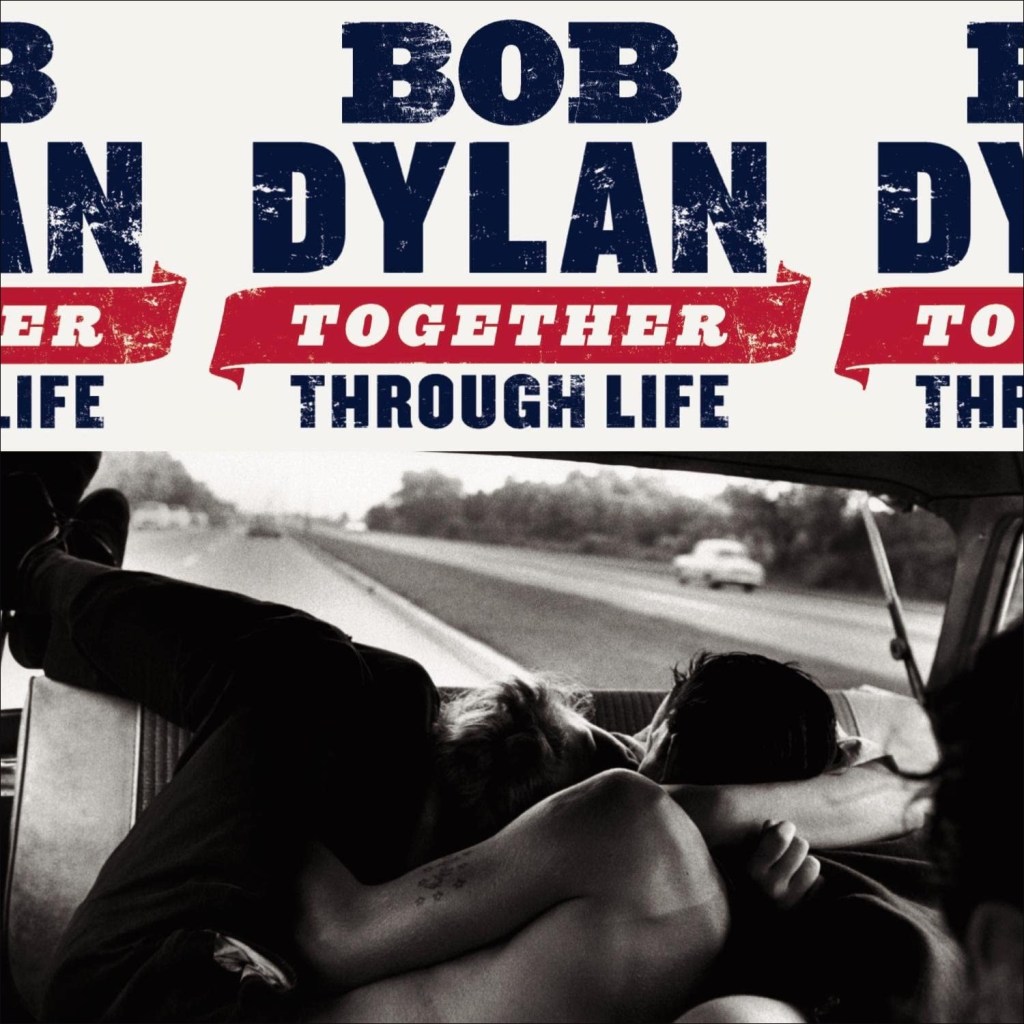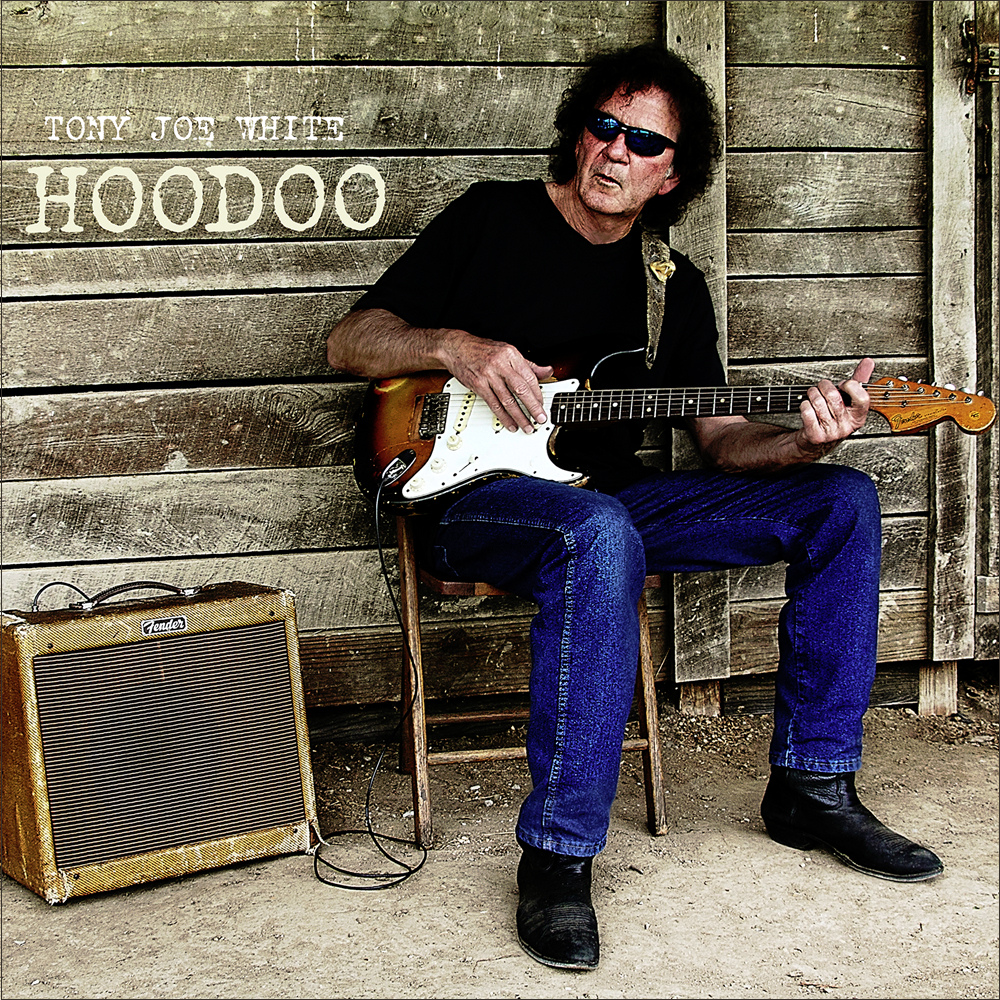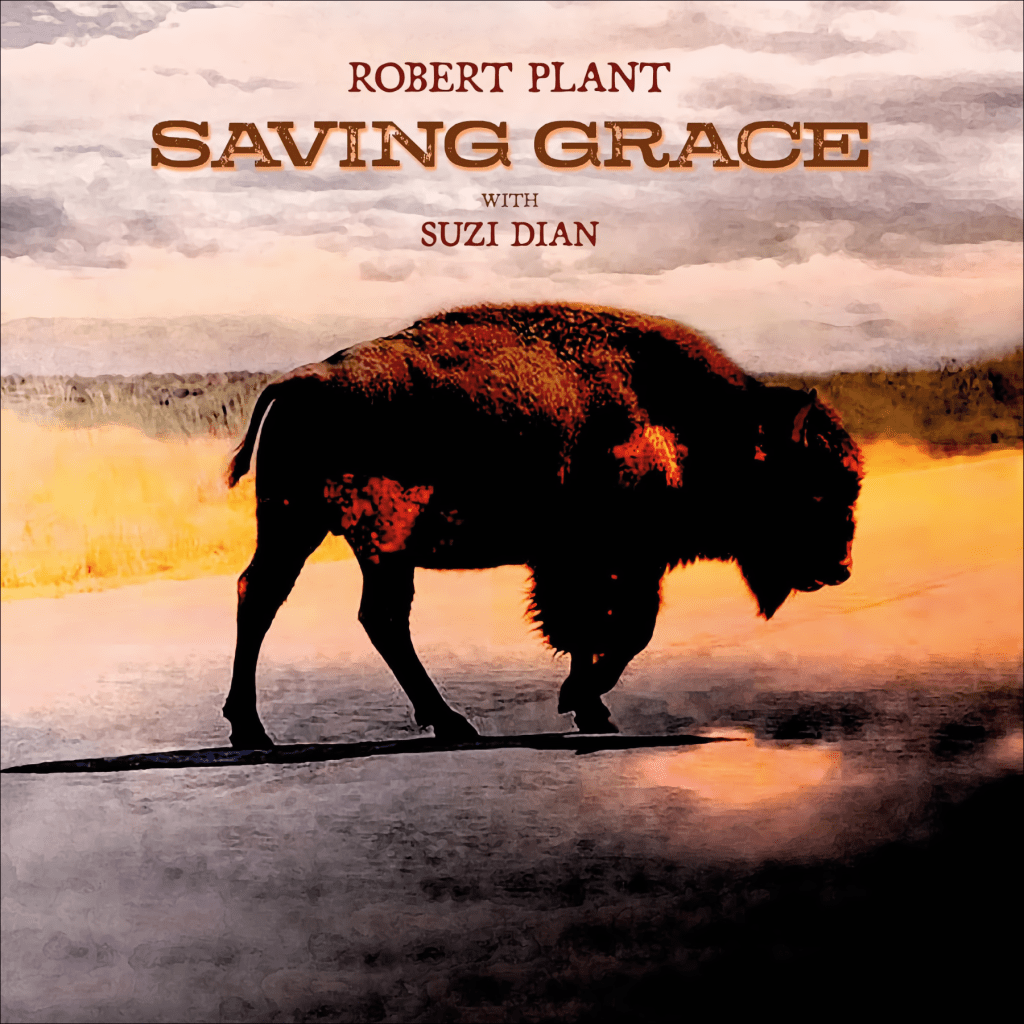Ray Davies, Other People’s Lives, 2006
Produzent/ Ray Davies
Label/ V2
Ray Davies, der 1963 die Kinks gründete und mit Songs wie „Sunny Afternoon“ sowie sozial-satirischen Konzept-Alben wie „The Village Green Preservation Society“ Klassiker der Popmusik schrieb, dieser brillante Chronist des britischen Kleinbürgerlebens, wurde im Juni 2025 einundachtzig Jahre alt. Auf seinem ersten Soloalbum „Other People’s Lives“ aus dem Jahre 2006 demonstriert er, was den Meister ausmacht: Ausgereiftes, mit leichter Hand serviertes Handwerk und Charisma. Viel Autobiografisches sei in die Songs eingeflossen, liess er verlauten – seine Erfahrungen mit dem „American Way of Life“ zu Beispiel.
Begleitet von seiner Liveband, die einen frischen Britpop spielt, klingt Davies zeitgemäss und doch klassisch. Mit seiner unverkennbaren, leicht näselnden Stimme geisselt er abgefuckte Dritte-Welt-Touristen, gibt den Misanthropen oder lästert über miese Komiker. „All She Wrote“ und „Creatures Of Little Faith“ schildern kaputte Beziehungen. Auch „After The Fall“ strotzt vor Pessimismus. „Next Door Neighbour“ grenzt an Selbstparodie (die privaten Disaster von Mr. Brown und Mr. Smith werden genüsslich in Kinks Manier zitiert). Ein schönes Alben, das mir ans Herz gewachsen ist.