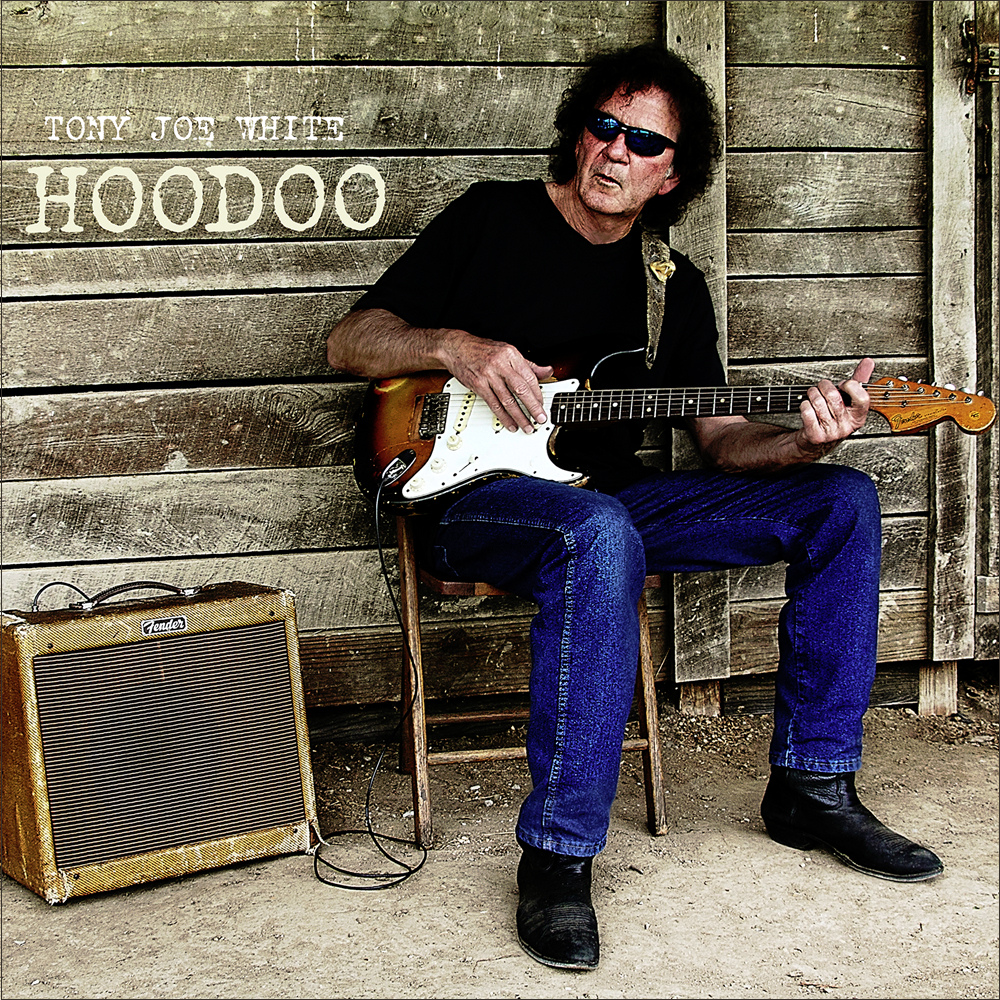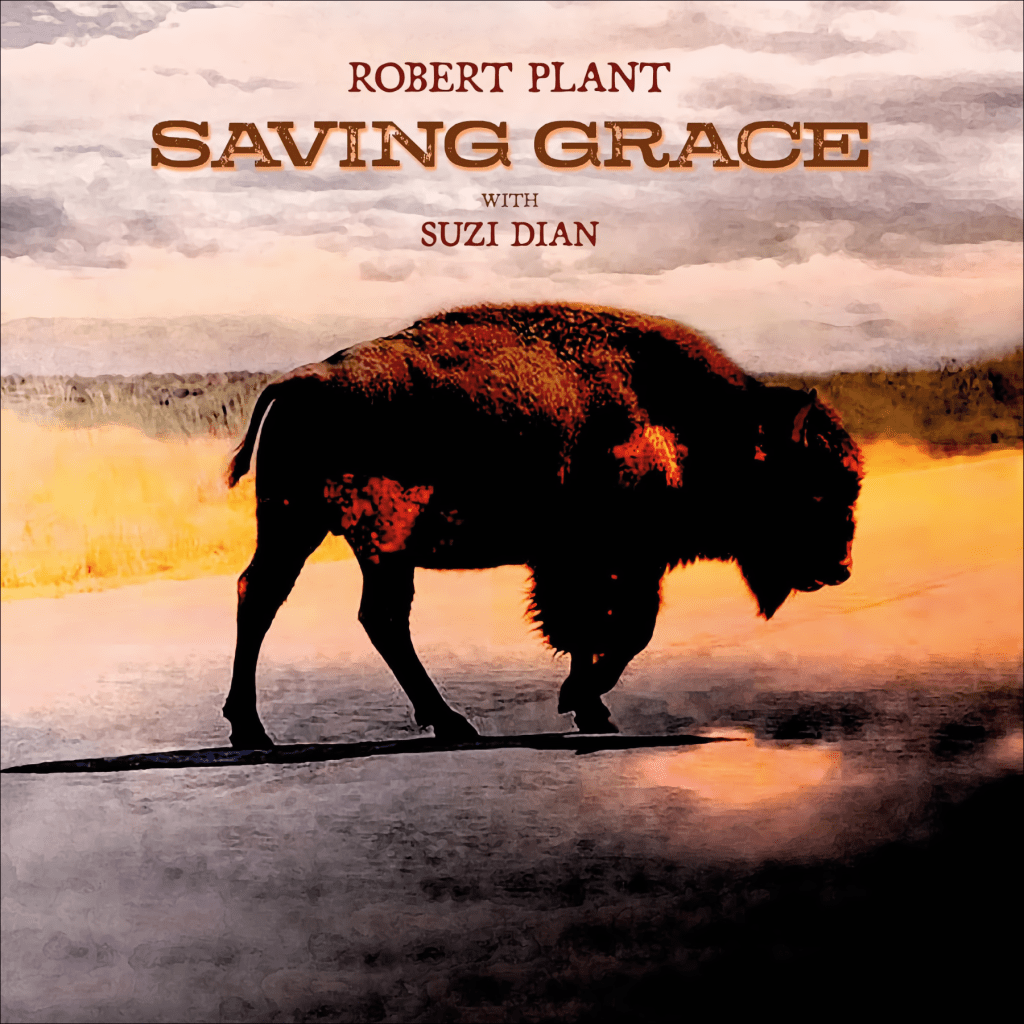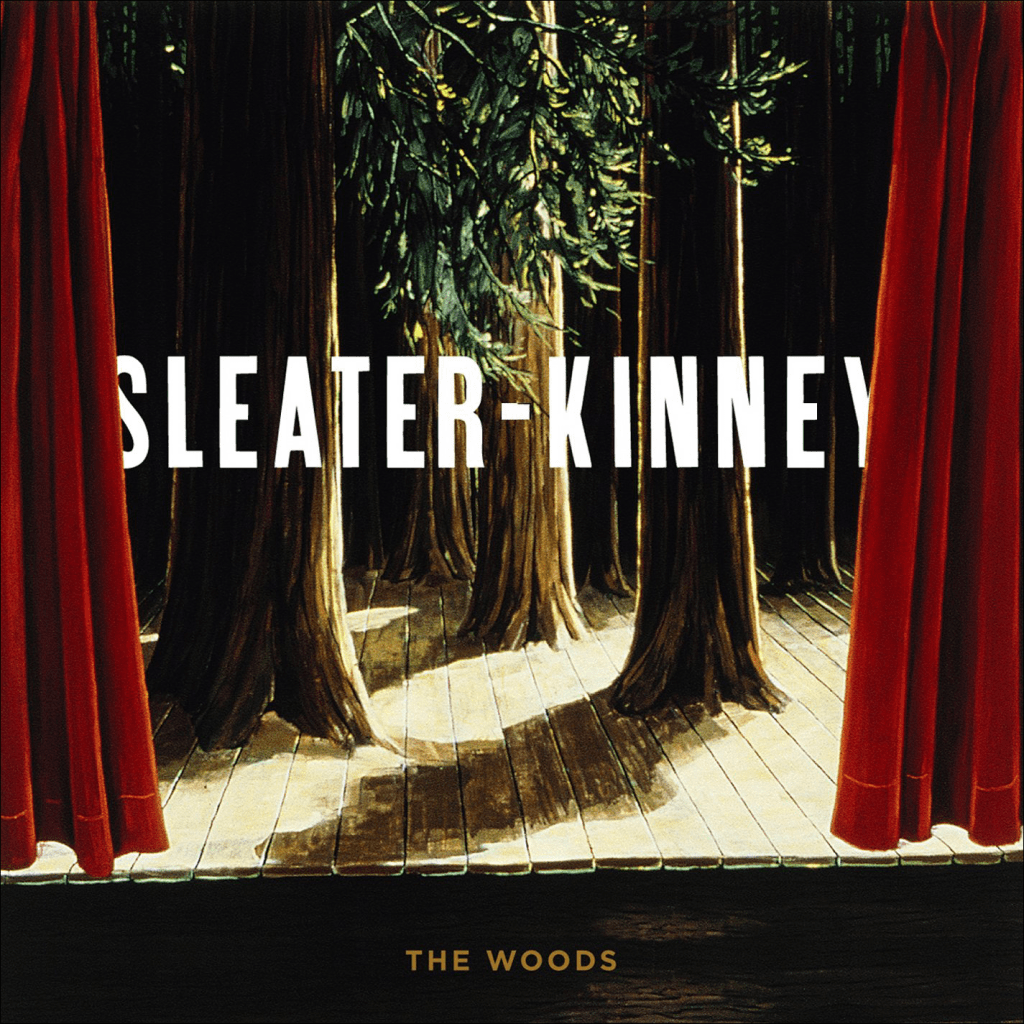Patti Smith Group, Radio Ethiopia, 1976
Produzent/ Jack Douglas
Label/ Arista
Bei einem meiner frühen Aufenthalte in London kaufte ich mir „Horses“ im Virgin-Plattenladen an der Oxford Street. Das deutsche „Sounds“ kaufte ich eine Woche später am Berner Bahnhofskiosk. Hier wurde sehr geschwärmt von Patti Smith. Das elegante Cover machte den Kauf noch unwiderstehlicher. Zu Hause erfasste mich Patti Smiths Debütalbum mit voller Wucht. Das zweite Album „Radio Ethiopia“ fand ich eher noch spannender. Es war wilder, weniger pathetisch und irgendwie einfach symphatischer.
Am 12. Oktober 1976 erlebte ich sie in der Roten Fabrik in Zürich – breitbeinig in augenfunkelnder Kampfpose schrie sie ins Mikrofon: „Where do we fight?“ und jedesmal antwortet die Band im Chor: „In the field!“, kurz bevor sie dann loslegten mit „My Generation“. Und bei „Radio Ethiopia“, live on stage, die Smith mit ihren typischen Unterbrechungen zwischen den Songs. Sie improvisierte im Monolog über ägyptische Kalligraphie und Körpersprache, versuchte sich an einer positiven Definition von Faschismus, schweifte ab und verlor ein paar Sekunden den roten Faden, bevor sie sich wieder auffing, an den Bühnenrand sprang und wie ein Derwisch tanzte und stampfte zum Rock & Roll ihrer Band. Unter den Anwesenden in der gut gefüllten Fabrikhalle schienen sich einige Konzertbesucher aber provoziert zu fühlen. Jedenfalls liess dann jemand eine Tränengasbombe los, das halbe Publikum suchte das Weite, der Rest heulte ins T-Shirt, Smith und die Band spielten einfach weiter als sei nichts passiert. Grandios!