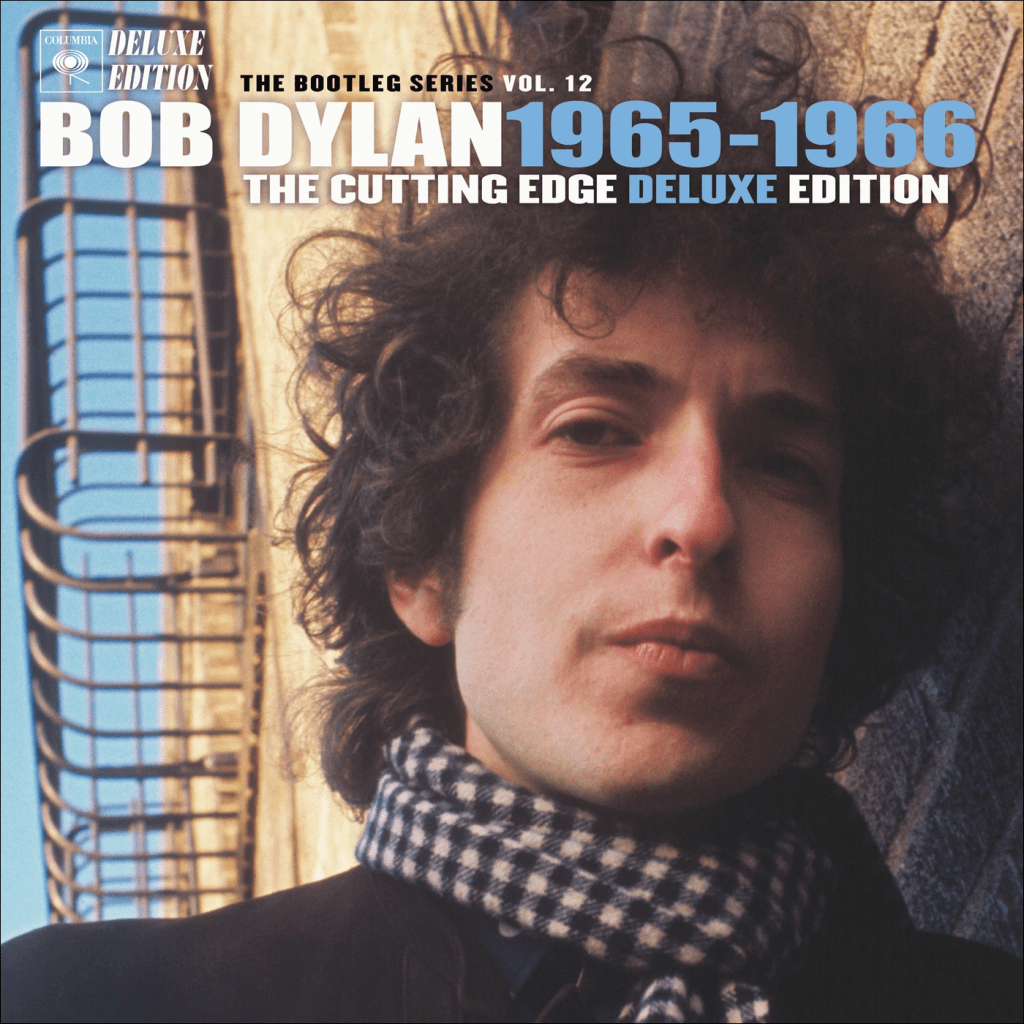Midnight Oil, Beds Are Burning, 1988
Text/Musik/ Midnight Oil
Produzent/ Midnight Oil, Warne Livesey
Label/ Columbia
Die Pintupi waren die letzten Ureinwohner Australiens, die ihre traditonelle Lebensweise aufgaben. Diese Aborigines waren erst 1930 in der Gibsonwüste entdeckt und später gewaltsam nach Papunya vertrieben worden, weil man weite Teile ihres Lebensraums in den 50er- und 60er Jahren für Nuklearwaffentests benötigte.
Jahrzehntelang wurden die Aborigines vom australischen Staat benachteiligt, tausende Kinder ihren Eltern weggenommen, um sie nach „weissen“ Grundsätzen zu erziehen, man verweigerte ihnen darüber hinaus die entsprechenden Entschädigungen und die Rückgabe ihres Landbesitzes. Deshalb schrieben Sänger Peter Garrett, Schlagzeuger Rob Hirst und Gitarrist Jim Moginie von der australischen Rockband Midnight Oil diesen Protestsong, der so eingängig und bassgetrieben daherkommt.
Gleich zu Beginn spielt der Text auf die Atombombenversuche an, erzählt vom vertrockneten Fluss, von Holden-Wracks – Holden ist ein australischer Autohersteller – und kochenden Dieselmotoren. Jetzt sei die Zeit gekommen, fair zu sein und endlich den entsprechenden Anteil zu bezahlen: „The time has come/ To say fair’s fair/ To pay the rent/ To pay our share.“ Das Land, das den Aborigines gehört, soll zurückgegeben werden: „It belongs to them/ Let’s give it back“. Auch ein erzwungener Umzug der Aborigines wird erwähnt: „Four wheels scare the cockatoos/ From Kintore East to Yuendumu.“ – „Vier Räder erschrecken die Kakadus/ von Kintore ostwärts nach Yuendumu.“ Wütend und verwundert fragt sich der Sänger, dann im Refrain, wie wir alle noch tanzen können, während die Erde sich dreht, wie wir noch schlafen können, während unsere Betten brennen… „How can we dance when our earth is turning/ How do we sleep while our beds are burning?“