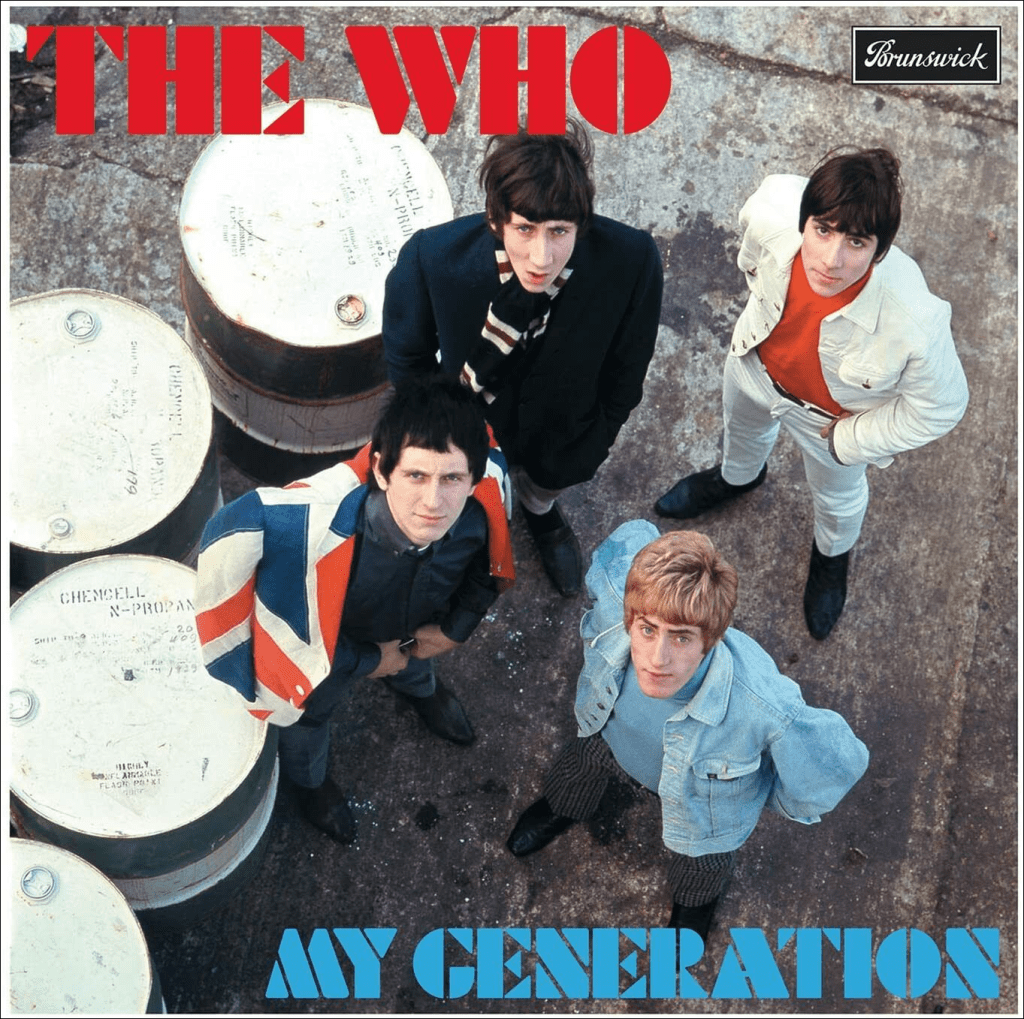Chuck Berry, Johnny B. Goode, 1958
Text/Musik/ Chuck Berry
Produzent/ Leonard Chess, Phil Chess
Label/ Chess
Seit Aufkommen des Rock ’n’ Roll ist die Gitarre das unangefochtene Instrument Nr: 1der musikalischen und persönlichen Selbstfindung, die Streitaxt jugendlicher Rebellion, die sich gleichzeitig ideal zur Begleitung adoleszenter Liebesseufzer eignet. Zwar wurde der „Tod der Gitarre“ mindestens so oft eingeläutet wie das „Ende der Geschichte“ – zur Hochzeit des Synthiepops in den 80er ebenso wie mit dem Aufkommen der Techno, DJ- und Clubkultur in den 90er -, doch die Klampfe behauptete stets hartnäckig ihr Terrain und schaffte immer wieder ein Comeback. Wer mal schon mal gesehen hat, wie zwei Nerds bei einem Elektro-Konzert lustlos auf ihren Notebooks herumdaddeln, weiss warum.
Kurzum: die Gitarre ist immer noch das Instrument mit dem grössten Sexappeal. Die Musikgeschichte ist voll von Liebeserklärungen an das Instrument. Eine der ersten und einflussreichsten ist sicher von Chuck Berry. In seiner epochalen Rock ’n’ Roll-Nummer „Johnny B. Goode“ geht es um einen Hillbilly-Boy, der sich durch sein phantastisches Gitarrenspiel den Weg aus ärmlichen Verhältnissen bahnt. Eine Geschichte, die auch auf Berry selbst zutrifft. Zudem gilt „Johnny B. Goode“ heute als das Stück, das der Gitarre den Status als Hauptinstrument des Rock’n’Roll verschaffte. Das sieht man auch in der mitreissenden Live-Version von Chuck Berry mit Bruce Springsteen und der E Street Band von 1995.