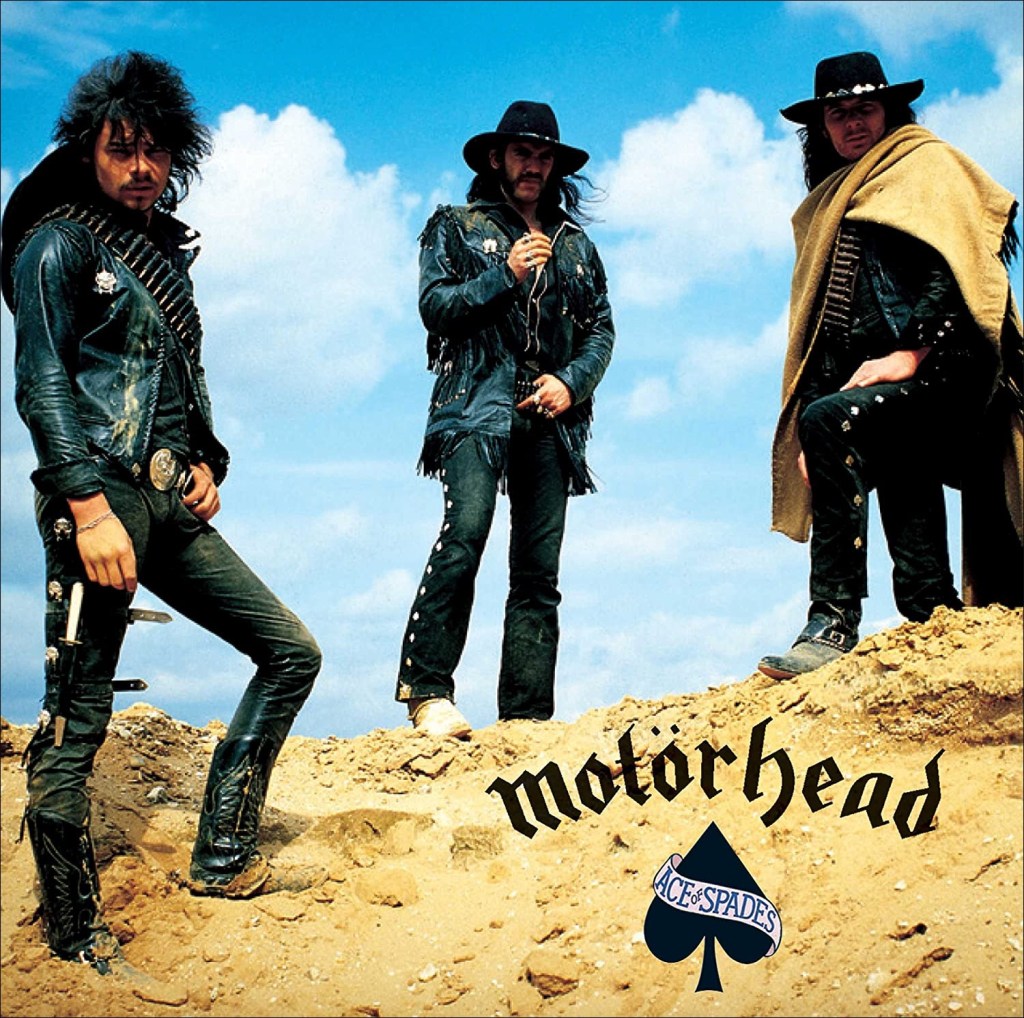Bob Dylan, Blind Willie McTell, 1991
Text/Musik/ Bob Dylan
Produzenten/ Bob Dylan, Mark Knopfler
Label/ Columbia
Bob Dylan erwies Blind Willie McTell – dem Blues-Sänger und -Gitarristen aus dem frühen 20. Jahrhundert, der mit „Statesboro Blues“ bekannt wurde – mehrfach die Ehre. Er coverte „Broken Down Engine“ und „Delia“ und erwähnte ihn in „Highway 61 Revisited“ und „Po’Boy“. Sein grösstes Hommage „Blind Willie McTell“ schrieb Dylan 1983, veröffentlichte sie aber erst viel später. Eigentlich wollte Dylan den Song auf „Infidels“ herausbringen. Dass „Blind Willie McTell“ dann doch nicht aufs Album kam, ist schwer nachzuvollziehen. Dylan erklärte das später so: “Er war nie richtig fertig. Ich schaffte es nie, den Song zu vollenden. Welchen Grund hätte es sonst geben können, ihn nicht auf die Platte zu tun?“
„Blind Willie McTell“ erschien schliesslich 1991. Der Song ist von ungewöhnlicher Schönheit. Er basiert auf der bekannten Klaviermelodie aus „St. James Infirmary Blues“ und glänzt mit erlesener Sprache in Form von fünf kurzen Vignetten über McTell, die Dylan mit inniger Überzeugung vorträgt. Dylans grösster Verdienst ist es jedoch, die Hörer mit diesem Song zu animieren, sich McTells eigene Musik anzuhören.