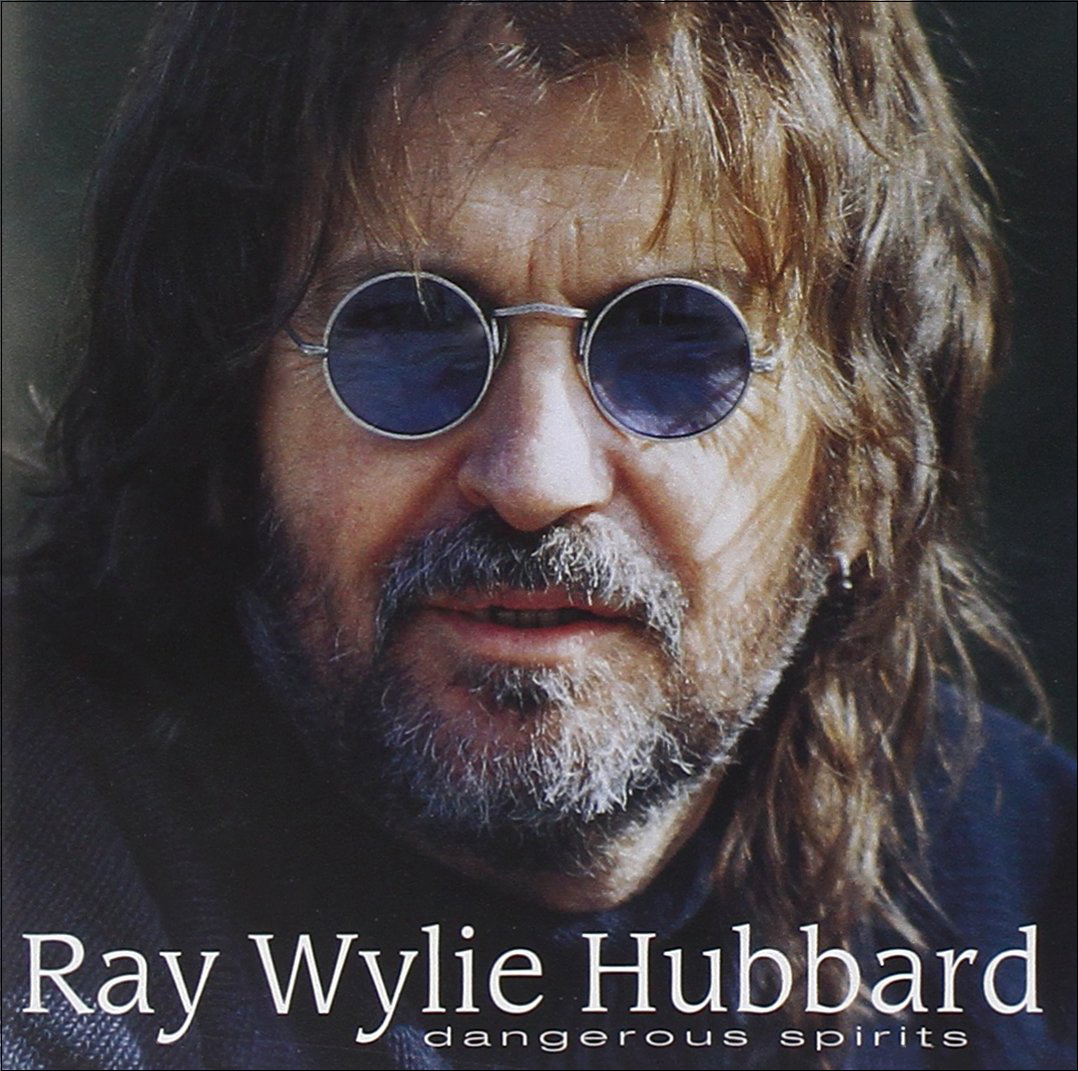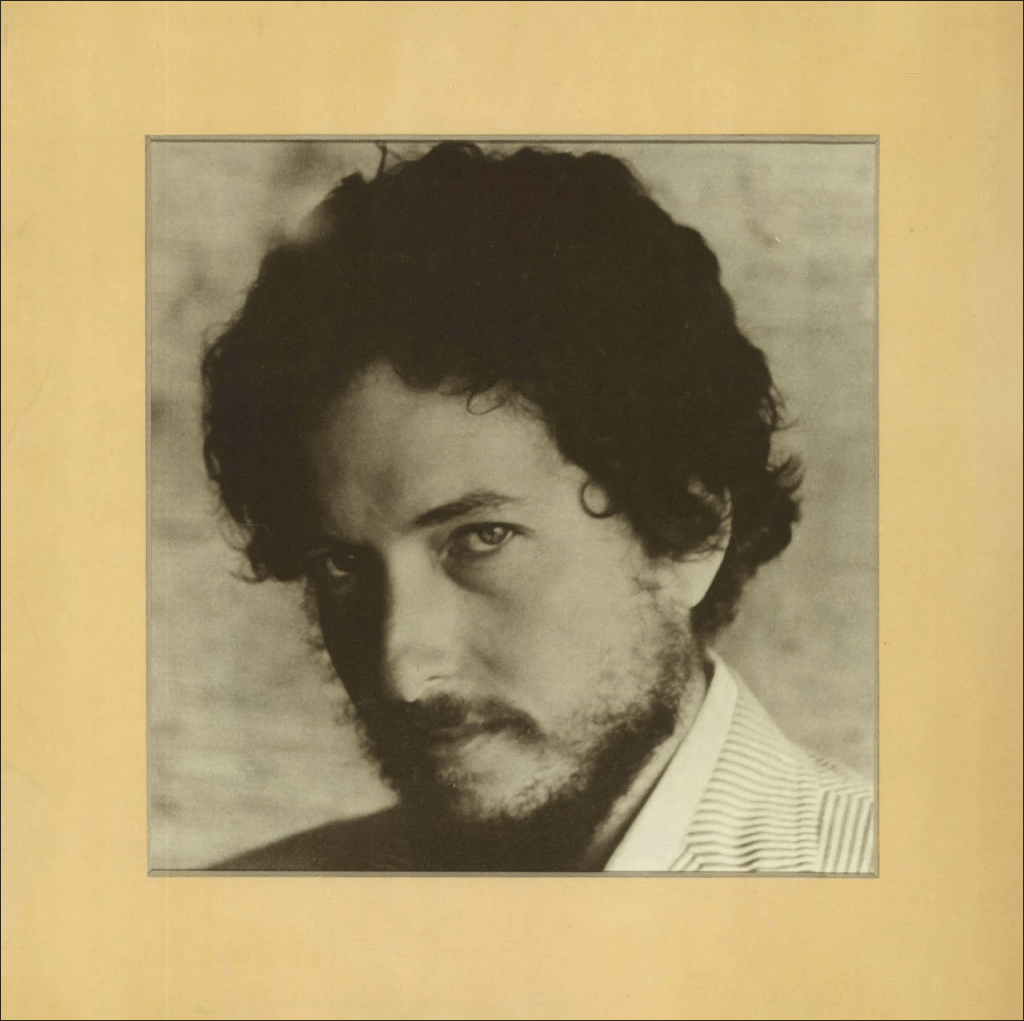Living Colour, Vivid, 1988
Produzent/ Ed Stasium, Mick Jagger
Label/ Epic
Die jungen, rauen Living Colour waren wie eine Band von einem anderen Stern. Kaum eine andere Band der späten Achtziger setzte den Begriff „Crossover“ so konsequent in die Tat um, verfügte über so viel Talent und konnte auf der Bühne so trefflich improvisieren. Das Debütalbum enthält den Kracher „Cult Of Personality“, der bei MTV im Tagesprogramm landete. Aber auch ein paar weitere Songs wie „Memories Can’t Wait“ und „Desperate People“ können überzeugen.
Phänomenal ist vorallem das Intensive Zusammenspiel des Quartetts. Will Calhoun und Muzz Skillings demonstrieren, welch unglaubliche agile Rock/Soul-Rhythmusgruppe sie sind und Sänger Corey Glovers Stimmumfang beeindruckt. Was auch immer er sich mal bei Prince abgeguckt hat, schreit er hier so druckvoll raus, dass sich das Nackenhaar sträubt. Und Gitarrist Vernon Reid ist ein begnadeter, origineller Vertreter seiner Zunft. Auf „Vivid“ gelangen Living Colour ein paar ausgefeilten Klanglandschaften und feurige Rhythmusattacken. Leider kamen alle späteren Werke nicht mehr an dieses phänomenale Debüt heran.