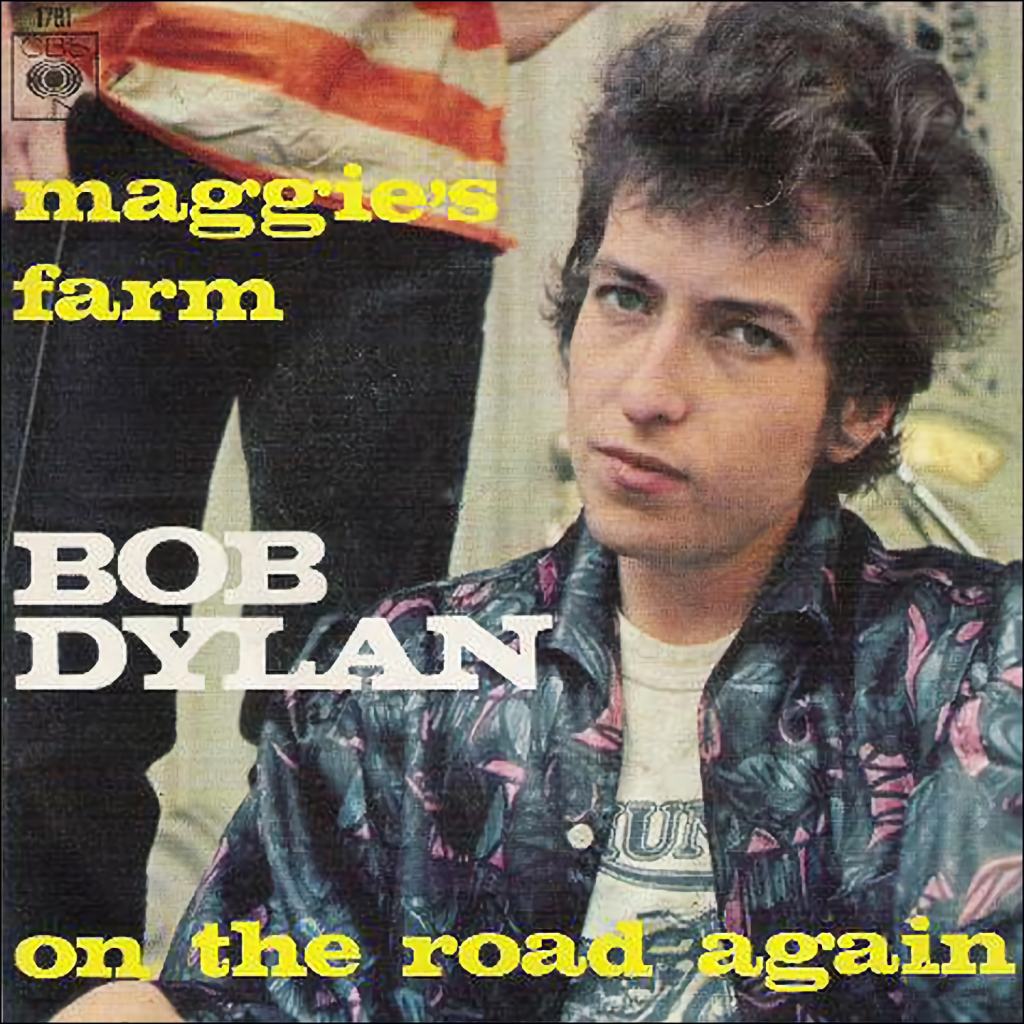Tex Williams, Smoke! Smoke! (That Cigarette), 1947
Text/Musik/ Merle Travis, Tex Williams
Label/ Capitol Americana
Ehrlich gesagt ist mir schleierhaft, wie man sich nach verrauchten Wirtshäusern und Büros zurücksehnen kann. Solange dieses Rauchen jedoch nur in Büchern, Filmen und in der Musik stattfindet, stört es mich nicht. Der Videoclip zu „Smoke Smoke Smoke that Cigarette“ von Tex Williams ist mit Werbespots (vorallem aus den Vierzigern und Fünfzigern) zum Thema unterlegt. Die Zigarette macht Männer zu coolen Jungs und harten Kerls; die vom blauen Dunst umhüllte Frau, deren glutroten Lippen den Glimmstengel liebkosen, wird zum mysteriösen, ja fatalen Wesen. Die Zigarette ist in einsamen Momenten des Manns einzige Freundin; beim Rauchen lässt sich angeblich bestens sinnieren und in Erinnerungen schwelgen – und ohnehin halten sich Raucher für bessere Geniesser als Nichtraucher.
Der Song „Smoke Smoke Smoke that Cigarette“ sollte hier aber nicht der Verherrlichung des Rauchens dienen, denn wie jeder mit Raucherfahrung weiss, wird dabei nicht nur genossen, sondern auch reichlich gehustet und geröchelt.