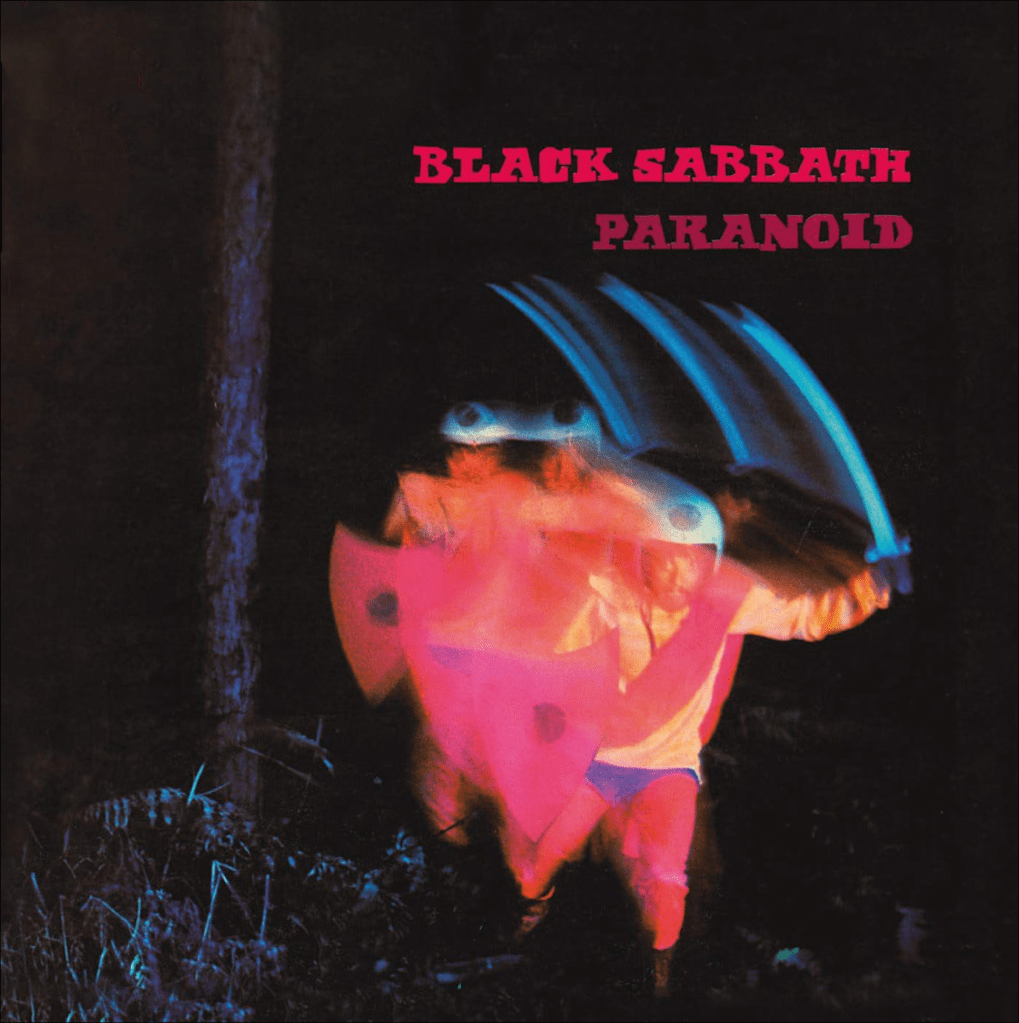Nancy Sinatra, These Boots Are Made for Walkin’, 1965
Text/Musik/ Lee Hazlewood
Produzent/ Lee Hazlewood
Label/ Reprise
Nancy Sinatras „These Boots Are Made for Walkin’“ nahm international die ersten Plätze ein. Eigentlich hatte Lee Hazlewood den Song für sich selbst geschrieben, aber Nancy bestand einfach darauf ihn zu singen. Woraufhin Lee ihr riet, das Ding dann auch nicht mit gewohnt hoher Kopfstimme, sondern eher aus Brust und Bauch heraus zu singen. So bekam das Lied, ursprünglich ein Country-Macho, einen feministischen, ja dezent sadistischen Unterton, und Nancys Image, einst ganz Daddy’s Little Girl, wurde, sowohl auf Platten wie im Film, durch eine fordernde Hooker- bzw. Bikerin-Dimension, zum reizvoll ambivalenten Wackelbild erweitert.
Abertausende haben sich bis heute die Zähne daran ausgebissen, ein Cover dieses Meilensteins aufzulegen – es geht nicht. Nancy Sinatras Erfolgsgeschichte bestand neben Lee Hazlewoods raffinierter Produktions-Regie, nicht zuletzt auch in den zwischen Surf und Country pendelnden, leicht hörbaren, aber durchaus funky Arrangements des 12-String-Gitarristen Billy Strange. 1966 erschien dann auch Nancys erstes Album, selbstredend „Boots“ betitelt, die Künstlerin posiert in roten solchen auf dem Cover.