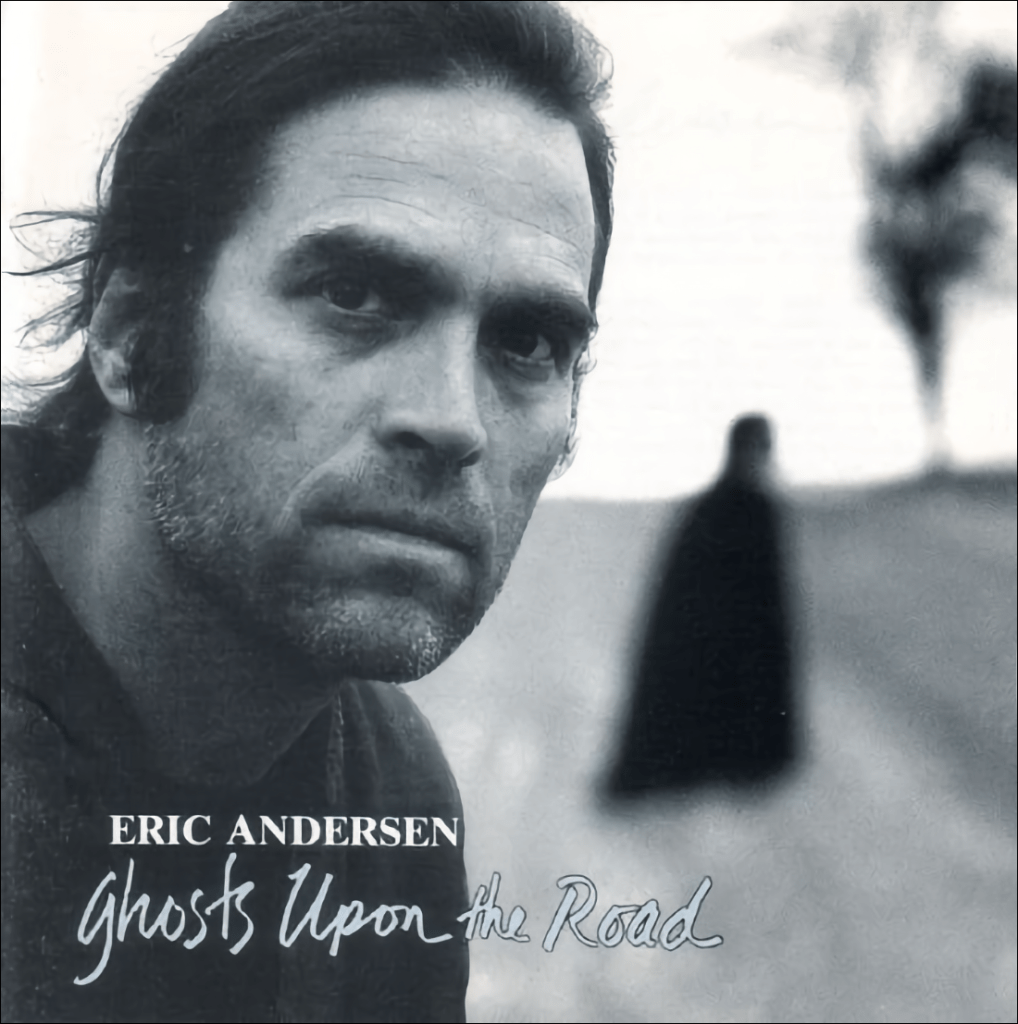Barrett Strong, Money (That’s What I Want), 1959
Text/Musik/ Berry Gordy
Produzent/ Berry Gordy
Label/ Motown Records
Der Motown Sound, der als „The Sound of Young America“ vermarktet wurde, war in der ersten Hälfte der 1960er Jahre ein Synonym für schwarze Popmusik, die sich auf dem umsatzstarken weissen Markt zu behaupten suchte. Lustigerweise war es Motown Chef Berry Gordy selber, der den Schlüsselsong der „pragmatischen“ neuen schwarzen Städter schrieb: „The best things in life are free/ but you can give them to the birds and bees/I want money/that’s what I want …“ Nicht die dubiosen Aufnahmestudios der traditionellen race-records-Firmen, die legendär viele Blues-Legenden um ihre Tantiemen gebracht haben, hatten die geschützten Räume der schwarzen Kultur zerstört, die Kirche und den Blues. Sondern, wie konnte es anders sein, die erste schwarze Kulturindustrielle zog die Konsequenzen aus einem veränderten Klima.
Der sprichwörtliche Ort der schwarzen Musik war die zugige Strassenecke Manhattans geworden, wo die DooWop-Gesangsgruppen entstanden. Gordy war der erste in einer Reihe von schwarzen und weissen Plattenfirmenbesitzern, der, anders als noch der Rock’n’Roll-Einzelhändler und Elvis-Entdecker Sam Philips, in industriellen Dimensionen dachte und seine Stars nicht an die grossen Plattenfirmen verkaufen musste. Das kam nicht nur dem Entertainment zugute, sondern auch den Verhältnissen in der urbanen Community: Motown Records wurde mit Abstand das erfolgreichste Pop-Label auf dem amerikanischen Musikmarkt der 1960er Jahre. Auch die Beatles hatten später „Money“ und eine ganze Reihe von Motown-Songs in ihrem Repertoire („Please Please Me“, „Please Mr. Postman“ „We Can Work It Out“, „Can’t Buy Me Love“, „Fool on the Hill“ etc.).