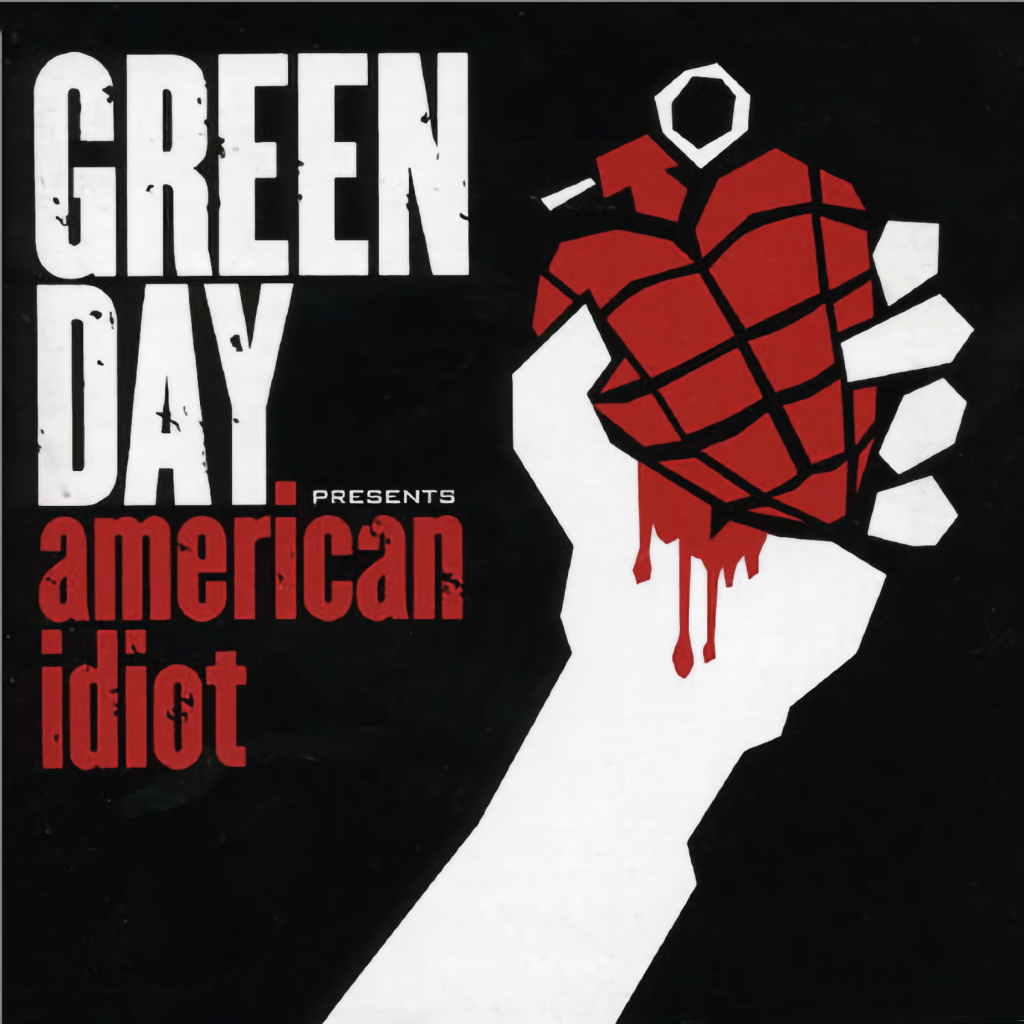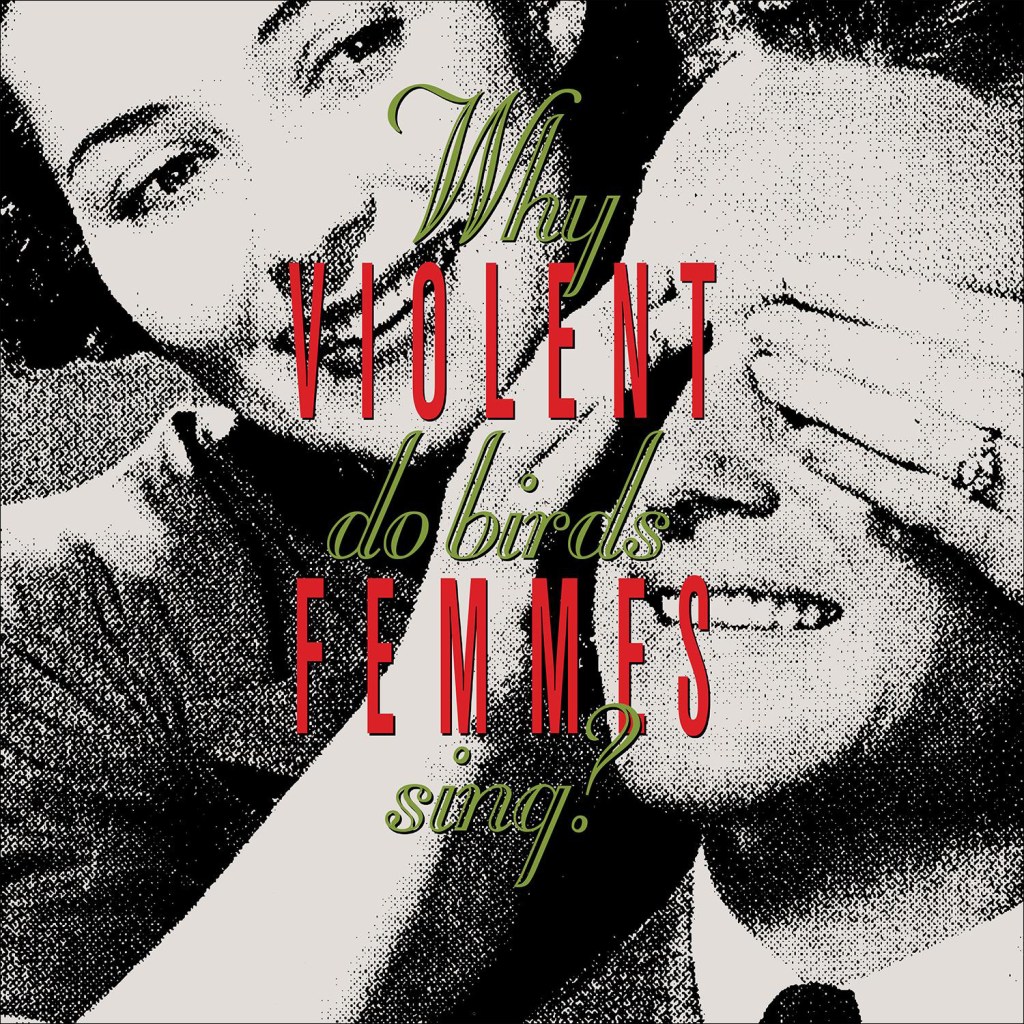PJ Harvey, Let England Shake, 2011
Produzent/ Flood, Mick Harvey, John Parish, PJ Harvey
Label/ Island Records
Kein PJ-Harvey-Album tönt wie das letzte, das war schon immer so. Man nehme nur schon die letzten Alben. Zuerst „White Chalk“, wo sie ihre Stimme erstmals in einem höheren Register erzwitschern liess und dazu neue post-folkige Saiten aufzog. Darauf folgte das beefheartig-speerige und laute „A Woman A Man Walked By“ an der Seite des alten Mitstreiters John Parish.
Parish ist auch auf „Let England Shake“ dabei, mit Mick Harvey, Jean-Marc Butty und Co-Produzent Flood. Und nie zuvor hat PJ Harvey einen mutigeren Seiten-, Quer- oder Weitsprung gewagt. Denn zum ersten Mal drehen sich ihre Texte nicht primär um ihre Innenwelt. Inspiriert von den englischen War Poets des ersten Weltkriegs, nimmt sie diesen als Ausgangspunkt für eine Reihe von vagen und doch emotional treffenden Beobachtungen über die Seele der heutigen Nation. Die Stimme hat sich in den hohen Lagen nun erst richtig eingenistet, kein Harvey-Album hat zudem mit so vielen so herrlichen Melodien aufgewartet („All And Everyone“!). Dabei ist die begleitende Musik durchwegs „versöhnlich“ eingestimmt. Aber irgendwie versteht es das Ensemble, den folkig-rockigen Grundton mittels Autoharp, Posaunen, Mellotron und Rhodes so weit von den ausgetreten Pfaden abschweifen zu lassen, dass man sich ständig wieder beim staunenden Gedanken ertappt, so etwas wirklich noch nie gehört zu haben. Sublim.