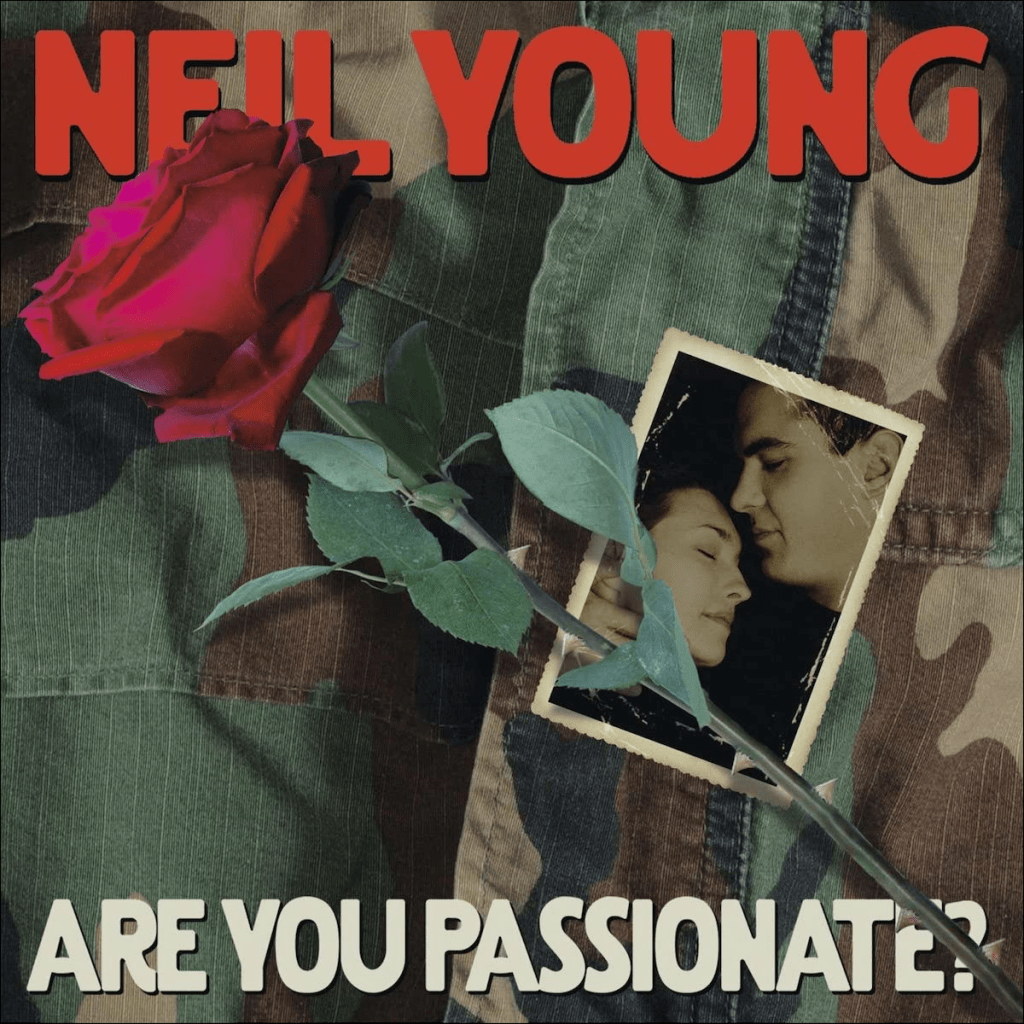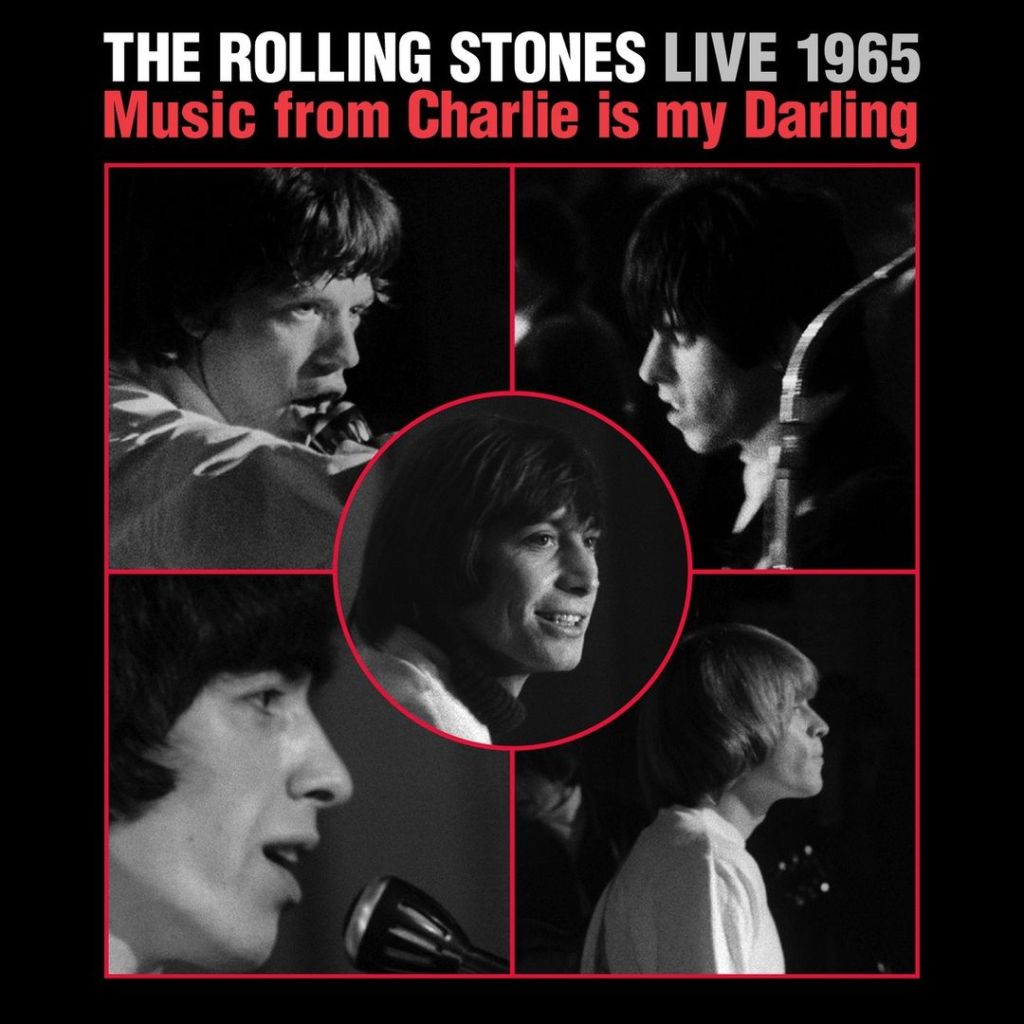J. J. Cale, Cocaine, 1976
Text/Musik/ J. J. Cale
Produzent/ Audie Ashworth
Label/ Shelter Records
Das Stück heisst „Cocaine“ und es wurde ein Hit, weil es ein genialer Bluesrock ist, mit einem kraftvollen Rhythmus, einem nachlässigen Riff aus zwei Akkorden, einem coolen Gesang und einem Solo, das sich selber für seinen Auftritt entschuldigt. Und es hat einen Titel und einen Text, der eine verbotene Droge am Ende jeder Strophe erwähnt. Da wird das Kokain als Entspannungsmittel und als Trost verherrlicht. Aber in der zweiten Strophe heisst es auch „If you want to get down, get down on the ground“. Das kann in diesem Zusammenhang feiern bis zum Ende bedeuten, aber auch den Absturz nach dem Hochgefühl.
Gerade wenn es um Drogen geht, ist die Rockmusik oft bewusst zweideutig. Letztlich kommt es darauf an, wie man einen Song interpretiert. Wer damals harte Drogen nahm, verstand das Stück vielleicht als Bestätigung und Verherrlichung. Wer kein Kokain nahm, freute sich einfach über einen lässigen Song, der etwas Verbotenes besang. Natürlich war da auch Provokation dabei, wenn die Eltern und andere Repräsentanten des Bürgertums zigmal den Refrain „Cocaine“ zu hören bekamen. Wer hingegen Cannabis und anderes Zeug nahm, der konnte sich schon ermutigt fühlen, mal Koks auszuprobieren. Der psychologische Mechanismus dahinter heisst „Selektive Wahrnehmung“. Man hört heraus, was man hören will.