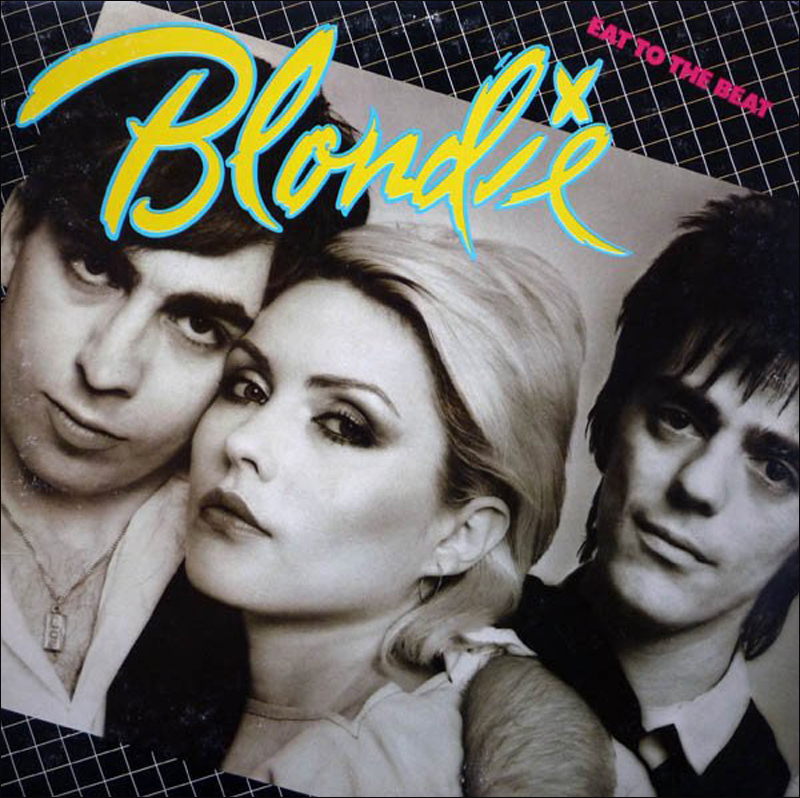Elvis Presley, I Washed My Hands in Muddy Water, 1971
Text/ Musik/ Joe Babcock
Produzent/ Felton Jarvis
Label/ RCA Victor
Es war ein unbekannter Zyniker aus Hollywood, der den oft weiterverwendeten Kurzkommentar abgab: „Smart Career Move“, schlauer Karriereschritt. Gemeint war der Tod von Elvis Presley am 16. August 1977. Wie recht der Mann hatte, zeigt das Vermögen, das seit dem Tod von Elvis mit dessen Namen erwirtschaftet wurde. Hohe Umsätze dank Platten, Memorabilia, Kleiderkitsch und Museumsbesuchen. Jedes Jahr seit seinem Tod, meldet die BBC, brachte der Kult um Elvis mehr als 20 Millionen Dollar ein, darunter eine Million verkaufter Platten. Dabei stirbt die Generation weg, die ihn schon kannte, als er noch lebte. Egal, sagen die Fans. Sie hören Elvis-Imitatoren zu, suchen Graceland auf, sein Heim in Memphis. Oder das Sun Studio, in dem Elvis seine ersten Aufnahmen machte.
Ein dänischer Unternehmer, der Graceland schon über 100-mal besucht hat, liess das Anwesen in der Stadt Randers nachbauen: als Museum, Restaurant und Verkaufsstelle. Elvis’ Lieblingssandwich gibt es dort für 15 Euro. Es besteht aus geröstetem Toastbroat, Speck, Bananen, Konfitüre und Erdnussbutter. Solches Essen hat wohl zu Elvis Presleys smartem Career Move beigetragen: Bei seinem Tod wog er 120 Kilogramm; er war 42 Jahre alt.