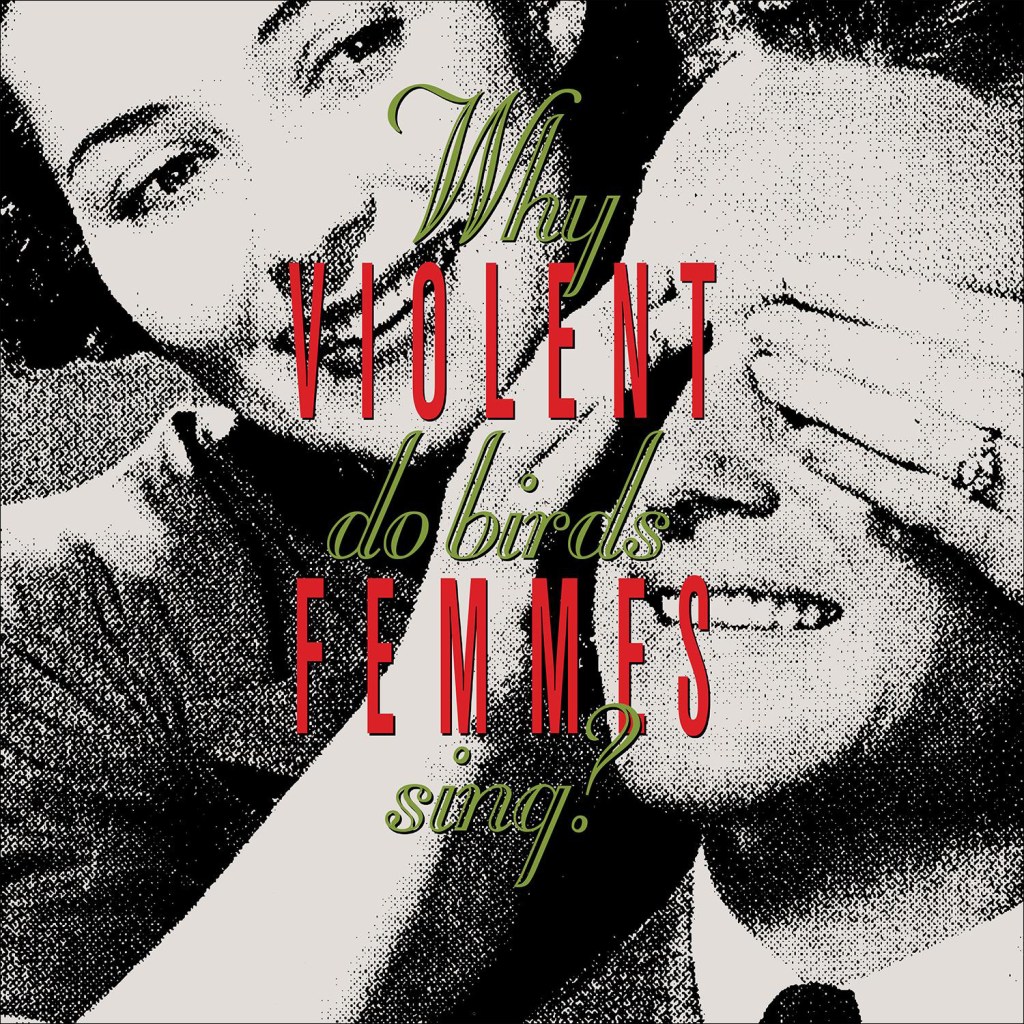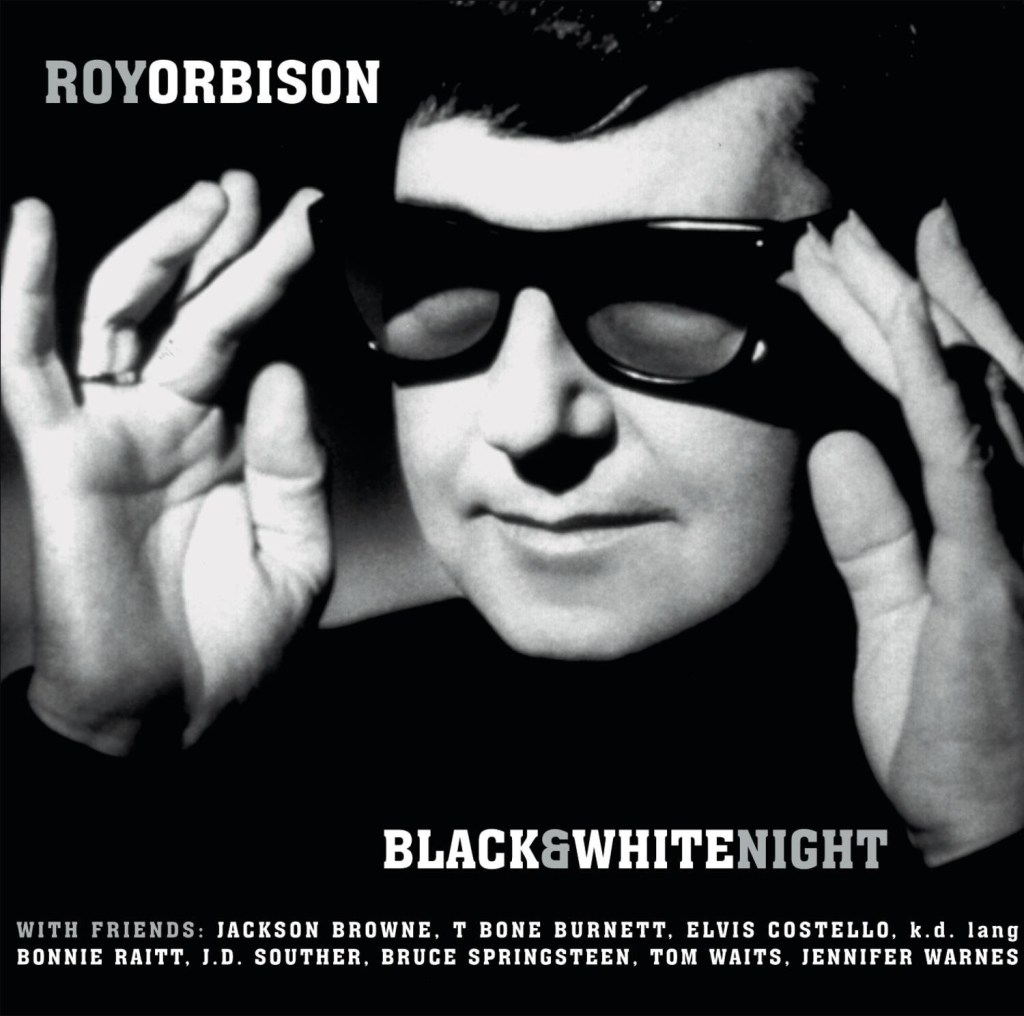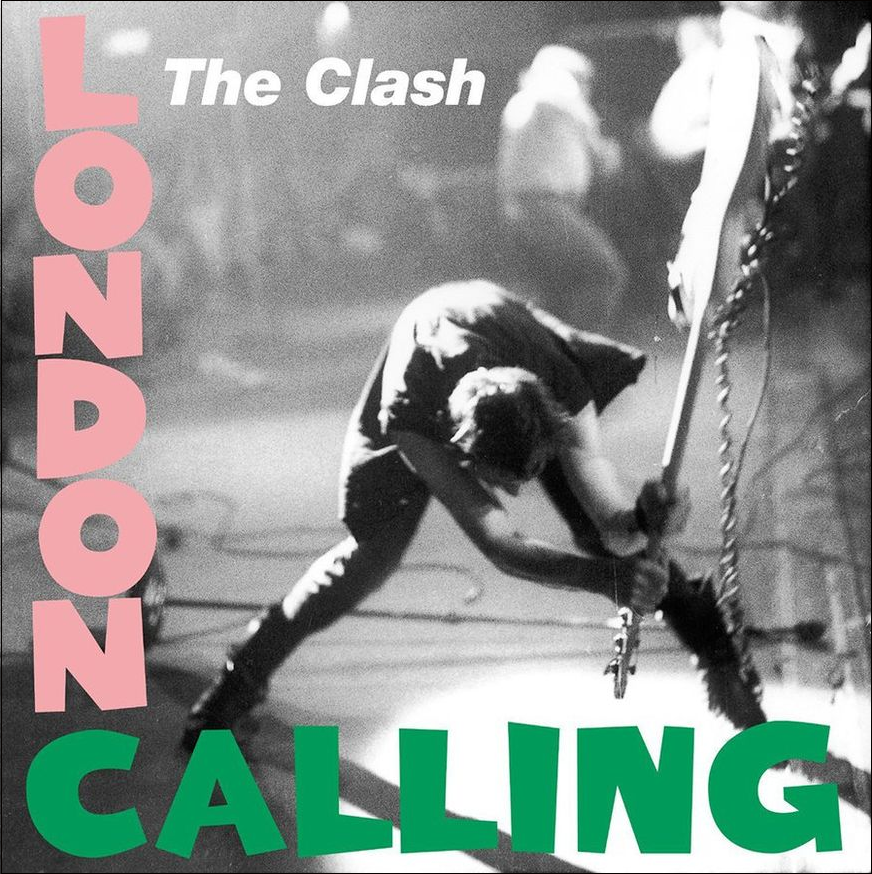Mavis Staples, We’ll Never Turn Back, 2007
Produzent/ Ry Cooder
Label/ Anti-Records
Mavis Staples, Grande Dame des Soul, erlebte 2007 ihr zweites Comeback. Ende der Achtziger hatte Prince die Sängerin aus der Versenkung geholt, danach war es Produzent Ry Cooder, Spezialist für groovende Geschichtsstunden, und Labelbesitzer Brett Gurewitz, Gitarrist der Emo-Punkrocker Bad Religion, die der damals 67-Jährigen einen neuerlichen – grossen – Auftritt ermöglichten.
„We’ll Never Turn Back“ steht ganz im Zeichen der US-Bürgerrechtsbewegung der Sechziger, zielt aber direkt aufs Heute. Der Wunsch nach gesellschaftlicher Erneuerung ist dabei verknüpft mit der Erinnerung daran, dass eine liberale Haltung nicht selten in der Spiritualität wurzelt. Herausragend unter all diesen musikalischen Juwelen sind „Down In Mississippi“, das langsam, wenn auch stark elektrifiziert, vor sich hin schlurft, sowie das fulminante Traditional „99 And ½“. Dieser Gospel schöpft wesentlich aus der Erfahrung. Mavis Staples kommentiert, ergänzt die Coverversionen um Originalzeilen und eigene Bemerkungen, macht Persönliches allgemein und umgekehrt. Dabei profitiert sie von einer exquisiten Produktion und exzellenten Mitmusikern (Neben Cooder: Drummer Jim Kelter, Bassist Mike Elizando, die Freedom Singers, Ladysmith Black Mambazo). Die aufregendsten Inspirationen für den neuen Soul liefert immer noch der alte.