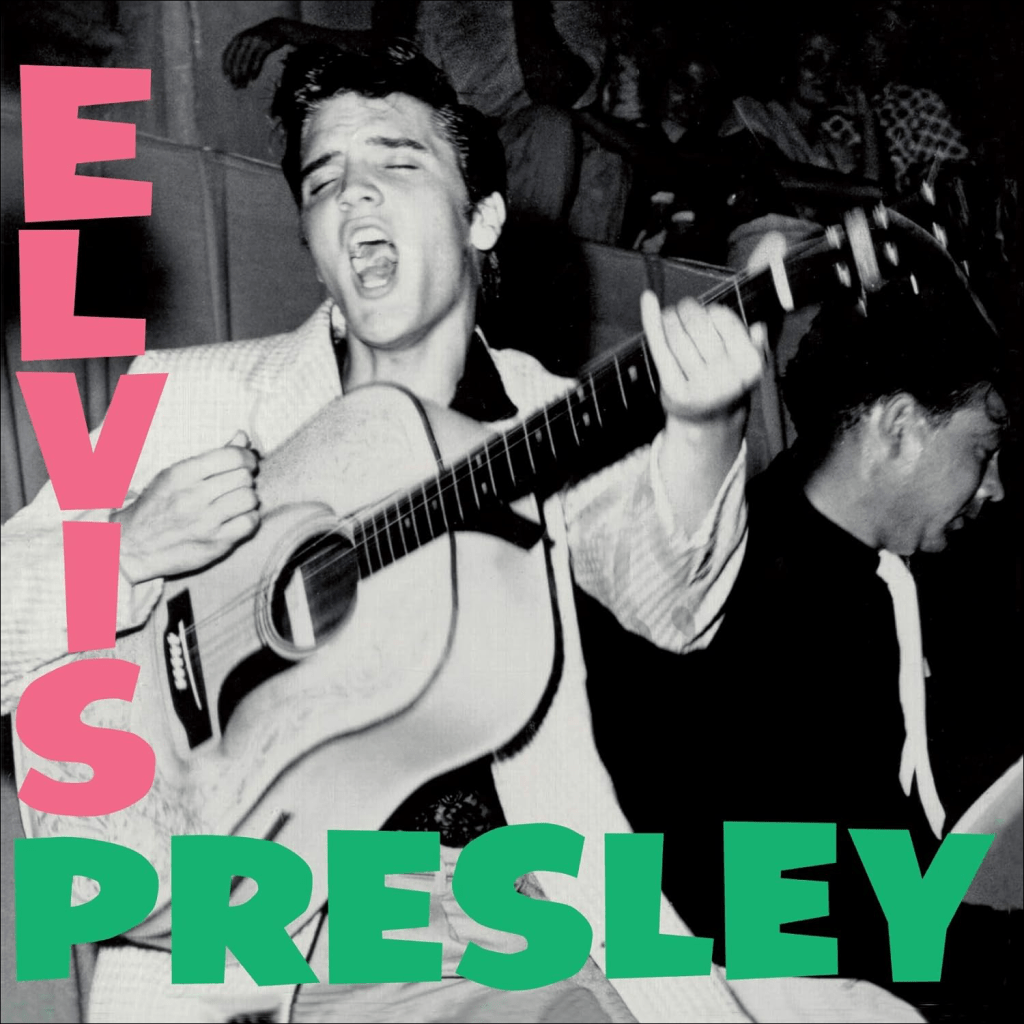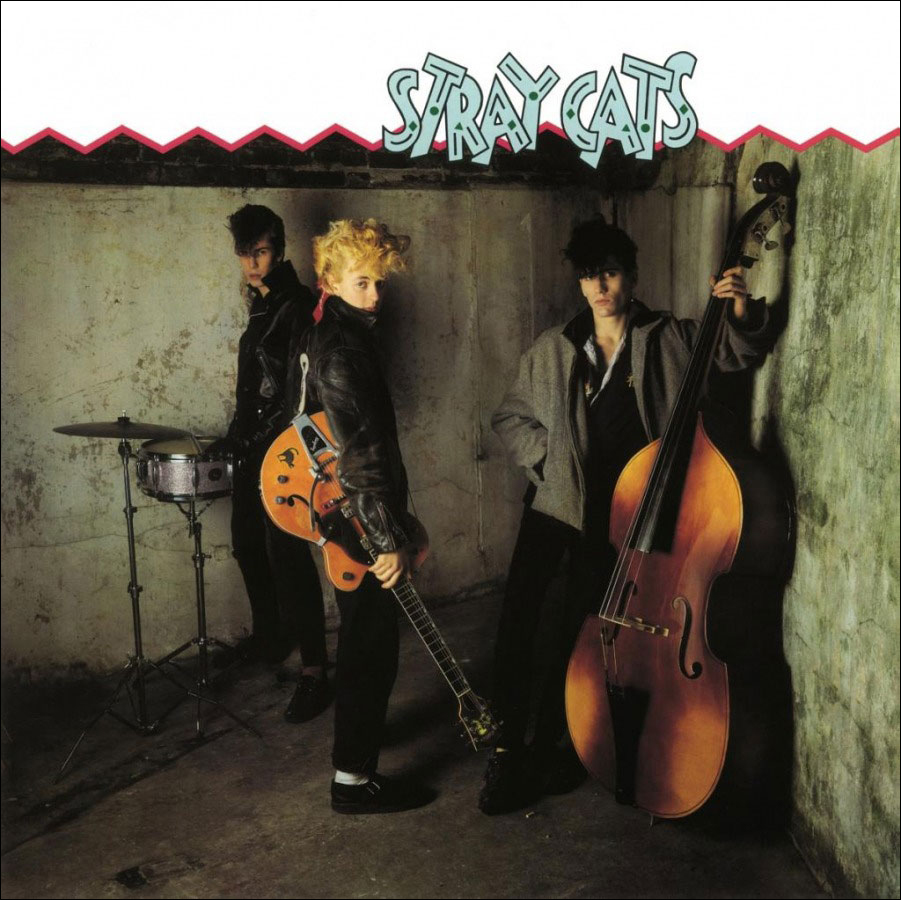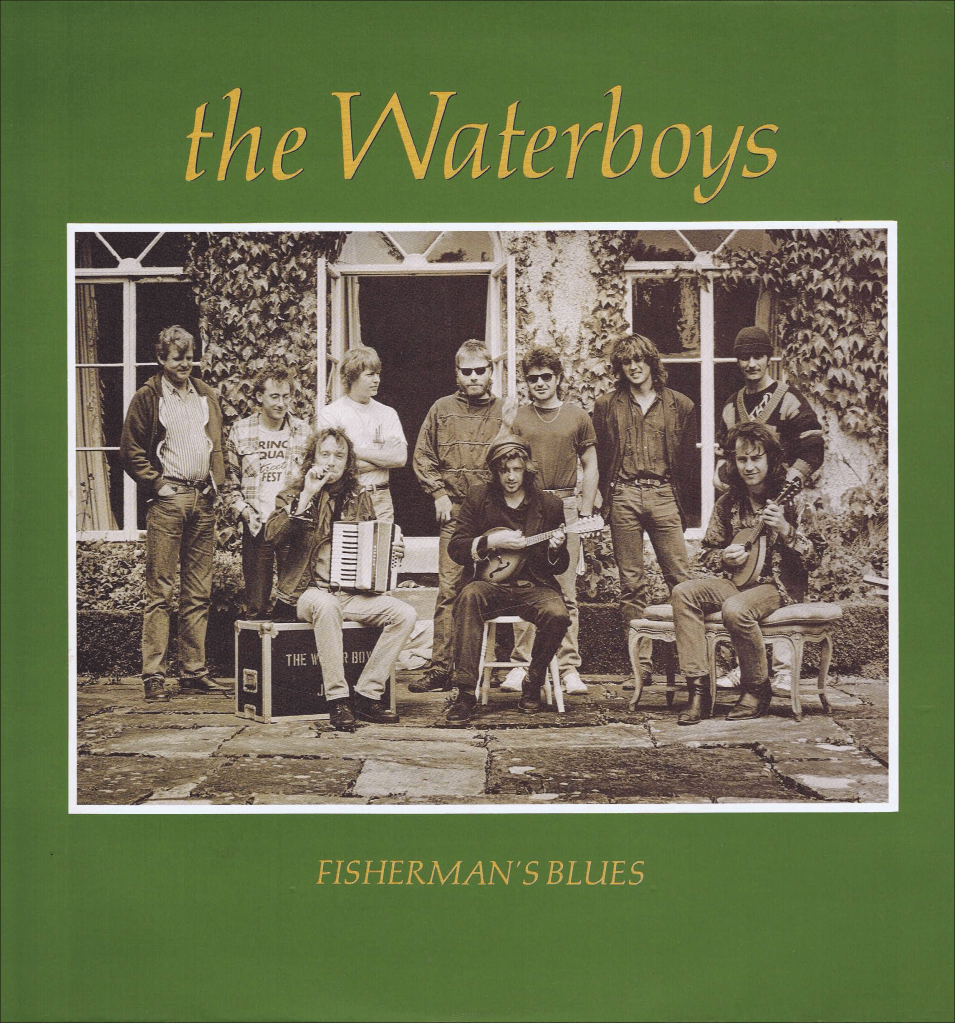Nirvana, Smells Like Teen Spirit, 1991
Text/Musik/ Kurt Cobain, Dave Grohl, Krist Novoselic
Produzent/ Butch Vig
Label/ Geffen Records
Es waren die späten Achtziger, und die Generation X langweilte sich schrecklich, als plötzlich eine chaotische Garagenband aus Seattle die Szene stürmte. Die zerbrechliche Frontfigur mit dem schmutzig-strähnigen Haar und dem Namen Kurt Cobain war genau, wonach sie suchte. Cobain sprach für Millionen von Jugendlichen, die nicht mehr an die Rockmusik glaubten. Man braucht sich nicht in die Musik von Nirvana zu vertiefen, um ihr wichtigstes Thema zu finden: die tiefe Unzufriedenheit mit der Masslosigkeit des Lebens. Und „Smells Like Teen Spirit“ war das Kampflied eines Gefühls, das jeder Heranwachsende kannte, aber keiner aussprach: Angst.
Aber nicht nur das, wofür sie standen, machten Nirvana zu einer wichtigen Band. Ironischerweise löste Cobains achtloser „Direkt-vom-Bett-auf-die-Bühne-Stil“ eine neue Modebewegung aus. Sein Leben auf der Überholspur faszinierte mindestes so stark wie seine Gitarrengriffe. Und wie alle wichtigen Rockepochen hatte auch Grunge eine Drogenkultur. Für seinen selbstzerstörerischen Narzissmus konnte Cobains Droge nur Heroin heissen.
Ausschlaggebend für Nirvanas Aufstieg in den Rockolymp war aber der 5. April 1994, als Cobain sich mit 27 Jahren eine Ladung Schrot durchs Hirn jagte – er beendete sein Leben, das so kurz war wie ein gutes Punkrockalbum. Im Abschiedsbrief hatte er Neil Young zitiert: „Better to burn out than fade away.“ Cobains Tod beflügelte die Verschwörungstheoretiker, aber er gab seiner Musik auch eine Romantik und Einzigartigkeit, die sie unberührbar und über jeden Zweifel erhaben macht.