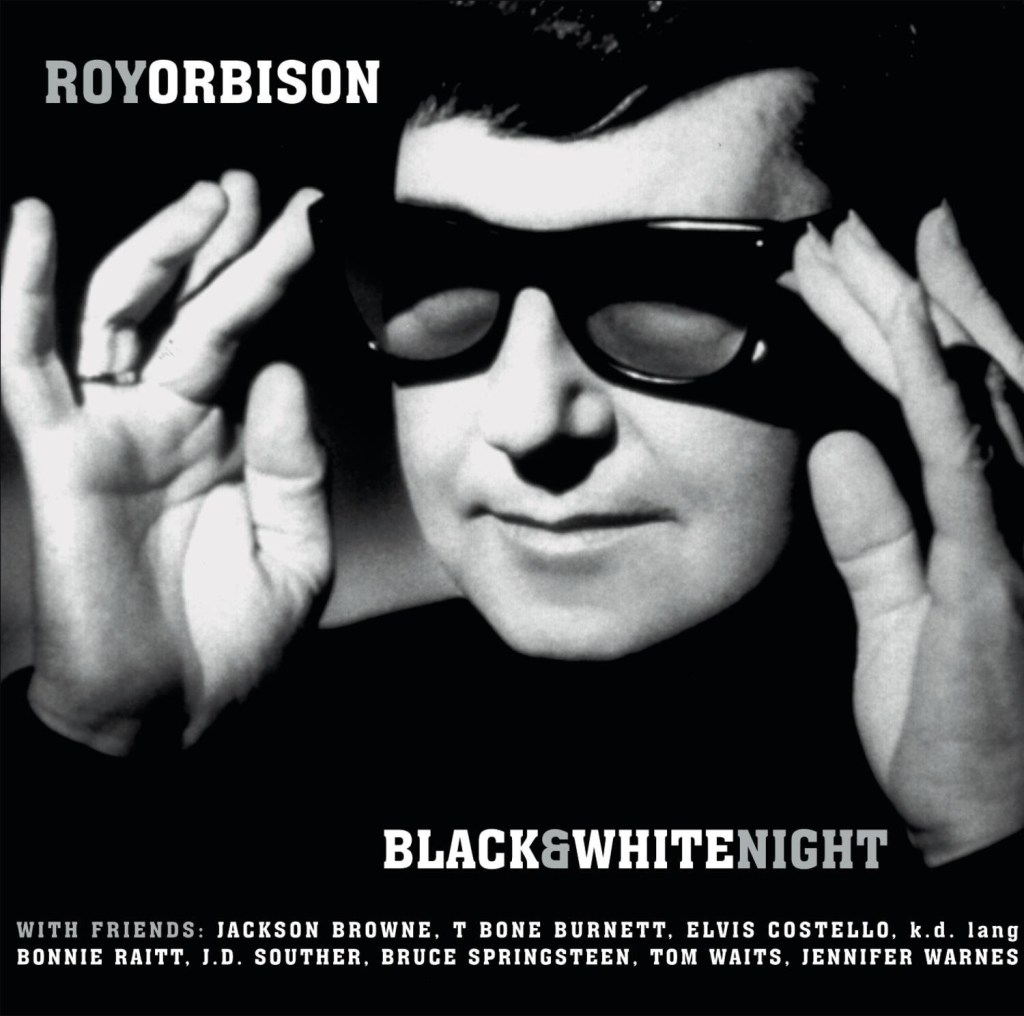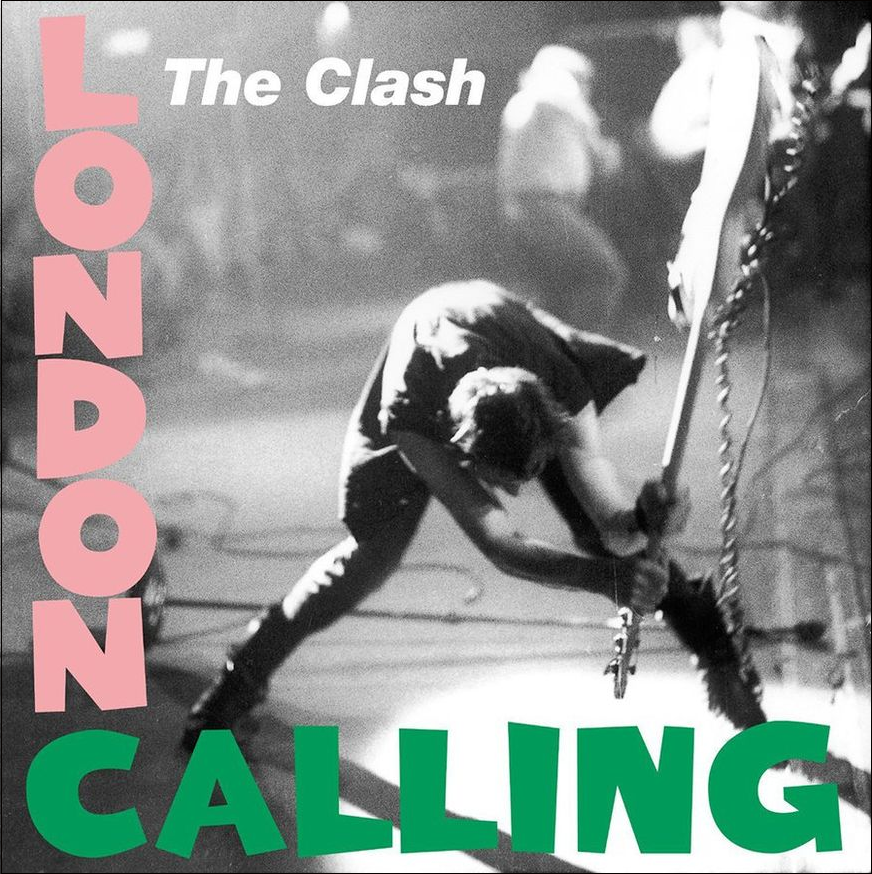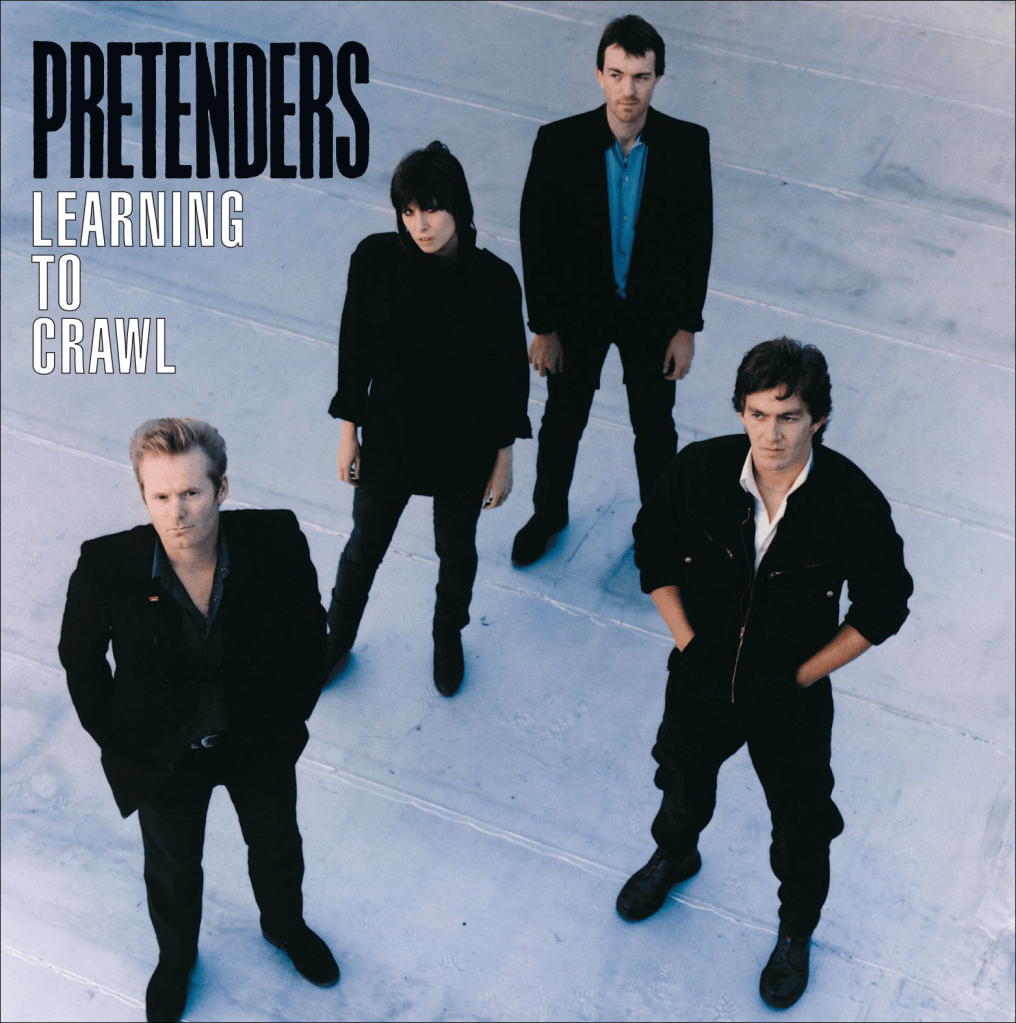The Replacements, Pleased to Meet Me, 1987
Produzent/ Jim Dickinson
Label/ Sire
Dünne, haarfeine Adern von Rock’n’Roll durchziehen die unaufdringlichen Songs, dort singt und schnarrt die Gitarre, ein Rascheln oder Säuseln kündigt vor fast allen Songs an, das sich die Musik uns gleich nähern wird. Man kann sagen, diese Gruppe hat den Namen Eklektizismus verdient. Hier sind echte Fans am Werk, aber Fans, die genug Vorlieben haben, um sich nicht entscheiden zu müssen: Unentschiedenheit als schöne Kunst, die berechtigte Liebe zu der zwischen der hübschen Melodie (Beat, England) und Rebel-Attitüden ( Amerika, der Süden, Outlaws) hin und hergerissenen Variante des 70er Rocks, um so in der Regel vergessene Gestalten wie Dwight Twilley, Speedy Keen, Todd Rundgren, The Stories und vor allem Alex Chilton, nach dem die Replacements gleich einen Song benannt haben. Zu dieser Traditionspflege addieren sich bei den Replacements tausend andere Ideen und Lieben und vorallem ein starker Wille zur Straffung, ein aus den Fehlern der anderen gelernt haben, eine Bremse gegen Verspieltheit. „Can’t Hardly Wait“ bohrt sich wundervoll ins Ohr und „Skyway“ ist ein reizender Song, der direkt aus einem Radioprogramm geboren wurde. Ein überzeugendes Album. Anspieltipps…