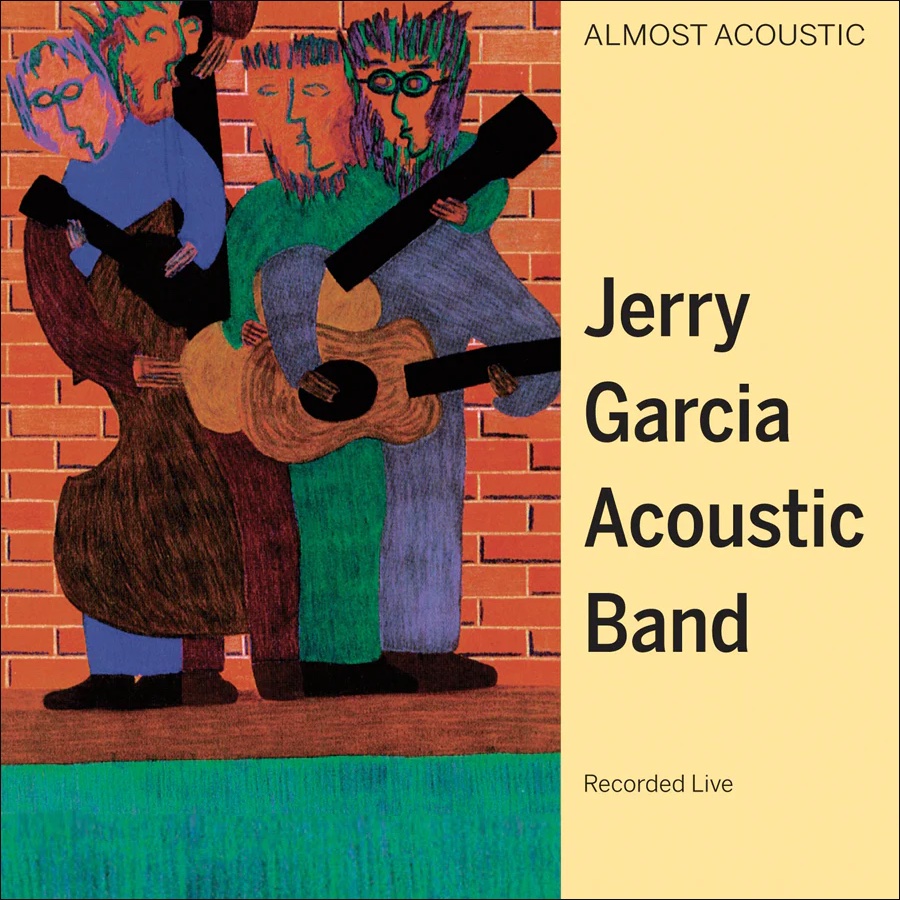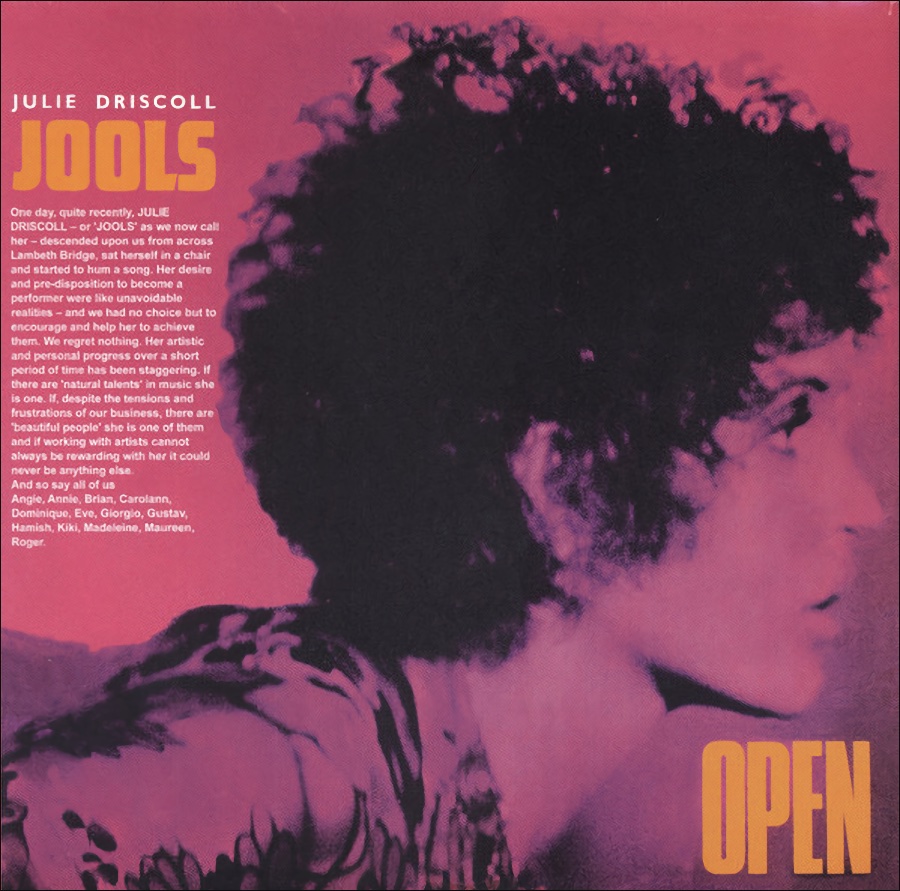Tom Verlaine, Warm and Cool, 1992
Produzent/ Tom Verlaine
Label/ Rykodisc
Tom Verlaine war das missing link zwischen der Pop-Art-Welt der 60er und Punk. John Cale, Patti Smith, Leute von Ramones und MC5 waren mit ihm befreundet. Als Sänger, Gitarrist und Poet der Band Television war er das Gross-Talent, der gerngesehene Session-Gitarrist, der Produzent, ein Musiker für Musiker, aber keiner für die Massen. Sein Gitarrenspiel ist ein Markenzeichen und Muster für andere, schimmernde Klänge, sich langsam brechende Kaskaden, die wie Luftspiegelungen auf heisser Fahrbahn oder wie Scheinwerferlicht auf nasser, nächtlicher Strasse flirren und irrlichtern.
Bestimmt kein Zufall, dass Verlaine so ein Photo als Cover für seine Instrumentalplatte „Warm and Cool“ ausgewählt hat. Das Album ging damals unter, ich weiss auch nicht: Instrumentale Rockmusik der 90er muss wohl anders klingen, mehr nach Chicago und nach Jazz und nicht so sehr nach Cowboystiefeln, die auf Grosstadtpflastern schiefgelatscht werden. Für mich bleibt Tom Verlaine der Ry Cooder seiner Generation, ohne dessen diplomatische Ader und völkerverbindende Art, mehr so ein One-Man-Soundtrack für den Film des Lebens.