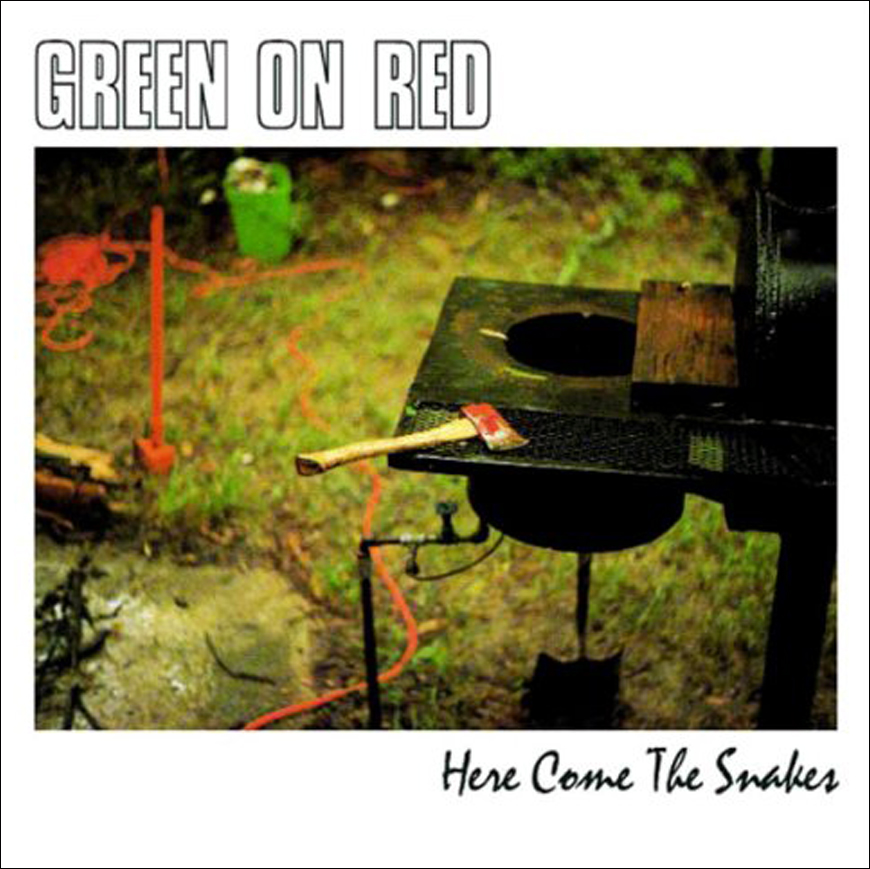The Gun Club, Fire of Love, 1981
Produzent/ Chris D., Tito Larriva
Label/ Ruby
Der Gun Club. Das Debütalbum „Fire of Love“ schürfte 1981 tief in der Musikgeschichte: Der Blues der 1930er klingt immer wieder durch, in den Akkordfolgen und auch im Gestus der Musik. Aber zusammengeschmissen mit dem zeitgenössischen Postpunk der frühen Achtziger. Natürlich ist alles zentriert um das Jaulen des egomanen, früh verfetteten, früh verstorbenen Jeffrey Lee Pierce. Der Sänger liebt Rituale. Die Grossstadt hat ihn aufgenommen, ein echter Sohn des heissen Pflasters, aber in seiner Seele wüten Aberglauben, puritanisch religiöser Wahn und der halsstarrig amerikanische Traum gegen alles Wissen um Tatsachen und aufgeklärte Vernunft. Die Wüste ruft in die Einsamkeit und Verlorenheit, auf endlose Highways und immer auf der Flucht vor den Blechdosen am eigenen Schwanz. Wenn man „Fire of Love“ hört, schluckt man soviel Staub, dass die Lungen platzen.
Was ist ein Amerikaner, der sein Land hasst? Wenn auch das letzte Ideal nackt und frierend, würdelos im Regen steht, hetzt er ruhelos und verzweifelt die Gespenster, die ihn jagen. Sie wollen ihm sein Land miesmachen. Gun Club sind wie Jerry Lee Lewis der angesichts von „Great Balls Of Fire“ plötzlich vor dem göttlichen Gericht zittert. Und dann trotzdem singt. „Got my mojo working, but it just don’t work on you…“. Wie gesagt, die Platte ist gut, vorallen nachts, wenn man nicht einschlafen kann. Manchmal zählt eben nicht die richtige Tonart, sondern die richtige Tönung.