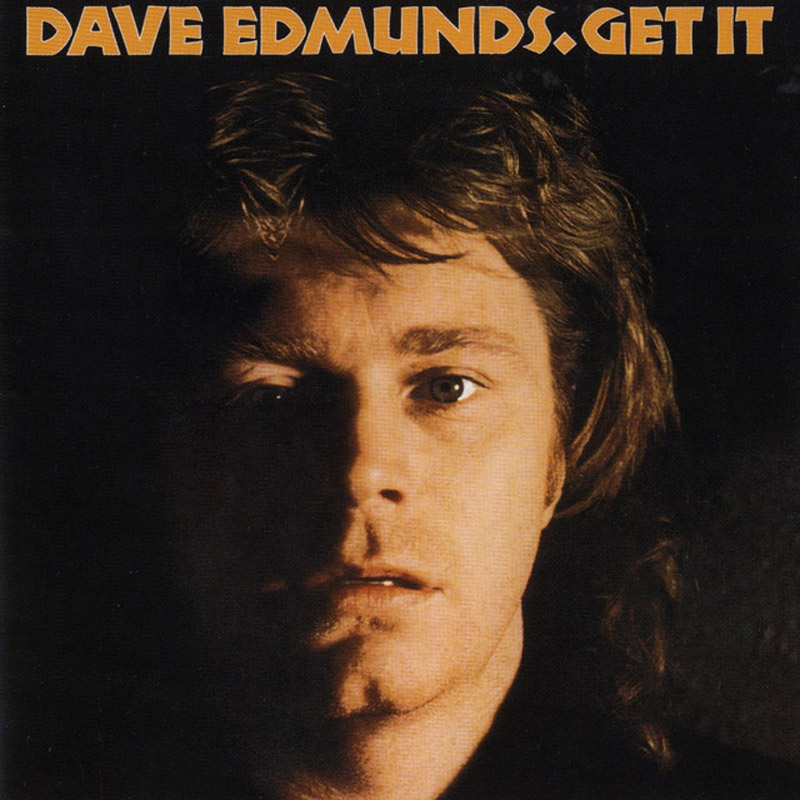Beth Orton, Central Reservation, 1999
Produzent/ Victor Van Vugt, Ben Watt, Mark Stent
Label/ Heavenly Records
„Central Reservation“ markierte eine Art Reifeprozess, nachdem ihr Debüt-Album „Trailer Park“ von 1996, ein Mix aus Folk und subtilen Trip Hop-Beats war.
In dem ersten Stück „Stolen Cars“ spielt Ben Harper in einer hypnotisierenden Art und Weise Gitarre. Das bewegende „Pass In Time“ beginnt mit dem weichen Gesang Ortons und einer sanft gezupften Gitarre, und entwickelt sich zu einem kraftvollen Song, der von einem wiederkehrenden Thema in Ortons Texten handelt, dem Tod ihrer Mutter. Im Hintergrund ist der amerikanische Jazz- und Folkgitarrist Terry Callier zu hören. Seine Arpeggien tragen zu einem wundervollen, erhebenden Sound bei.
Die Akustik-Version des Titelstücks geht neben „Pass In Time“ und den hallenden Beats von „Stars All Seem To Weep“ fast vergessen. Hier wird Ortons leicht schwebende Stimme mit verwobenen, abstrakten Geräuschen von Ben Wyatt vermischt. Elektronik ist aber auf „Central Reservation“ eher die Ausnahme als die Norm. Im Vergleich zu „Trailer Park“ liegen die Stärken des Albums in der akustischen Atmosphäre und in Ortons fesselndem Gesang.
Beth Orton wird oft als melancholische Sängerin bezeichnet, aber die Fröhlichkeit von „Love Like Laughter“ dementiert diese Aussage. Beim letzten Song des Albums fügt dann Ben Watt erneut Beats und Keyboards hinzu, um eine Chart-freundliche Version von „Central Reservation“ zu kreieren.