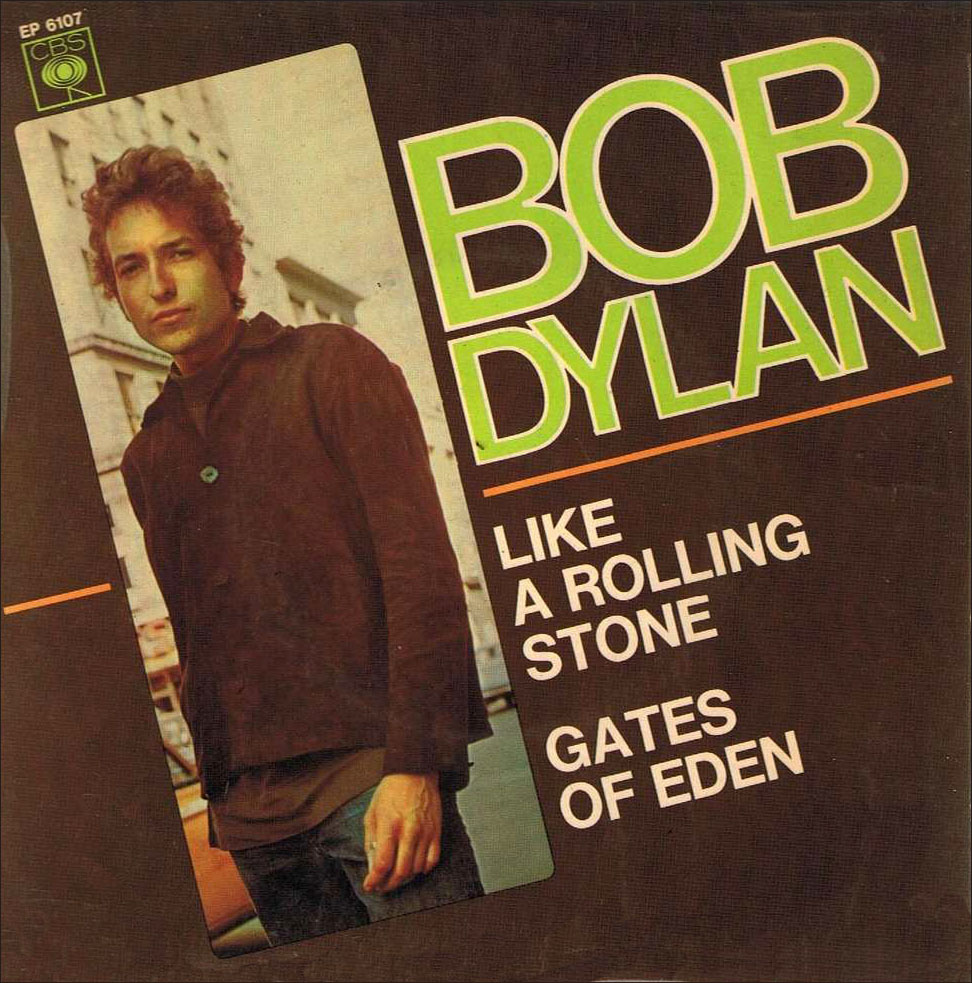Bette Midler, The Rose, 1979
Produzent/ Paul A. Rothschild
Label/ Atlantic
„The Rose“ ist wirklich kein guter Film, neben einigen starken Szenen gehören immerhin die Konzertmitschnitte zu den Höhepunkten. Gerade diese Passagen sollte man sich jedoch im Film ansehen, denn der Soundtrack verschafft zwar Musikgenuss, aber es fehlt hier einfach die Bühnenpräsenz von Bette Midler. Und die ist bei bei solchen Songs wie „Whose Side Are You On“, „When A Man Loves A Woman“ oder „Keep On Rocking“ so überzeugend, als ob sie ausschliesslich Rock’n’ Roll gesungen hätte.
Als Solisten in einer guten Band sind Norton Buffalo mit seinen swingenden Mundharmonikaeinwürfen und Steve Hunter erwähnenswert. Letzterer hatte vielleicht seinen stärksten Auftritt, indem er ein Instrumentalintro beisteuerte, welches sich ob seiner Eingängigkeit sofort in den Gehörwindungen festsetzt. Mit dem programmatischen „Sold My Soul To Rock’n’Roll“ liesse sich die Aussage des Soundtracks auf einen Nenner bringen, wenn da nicht der eigentliche Titelsong wäre. „The Rose“ ist ein Meisterstück der amerikanischen Klischeelieblingskunst, ein Werk, mit dem Frank Sinatra seine fünfte (oder wievielte) Karriere hätte beginnen können. Und das ist der Song, den ich zur Zeit immer wieder gerne auflege – wenns Frühling wird, sollte die Liebe eigentlich wieder blühen, auch wenns in der echten Welt draussen ganz anders aussieht.