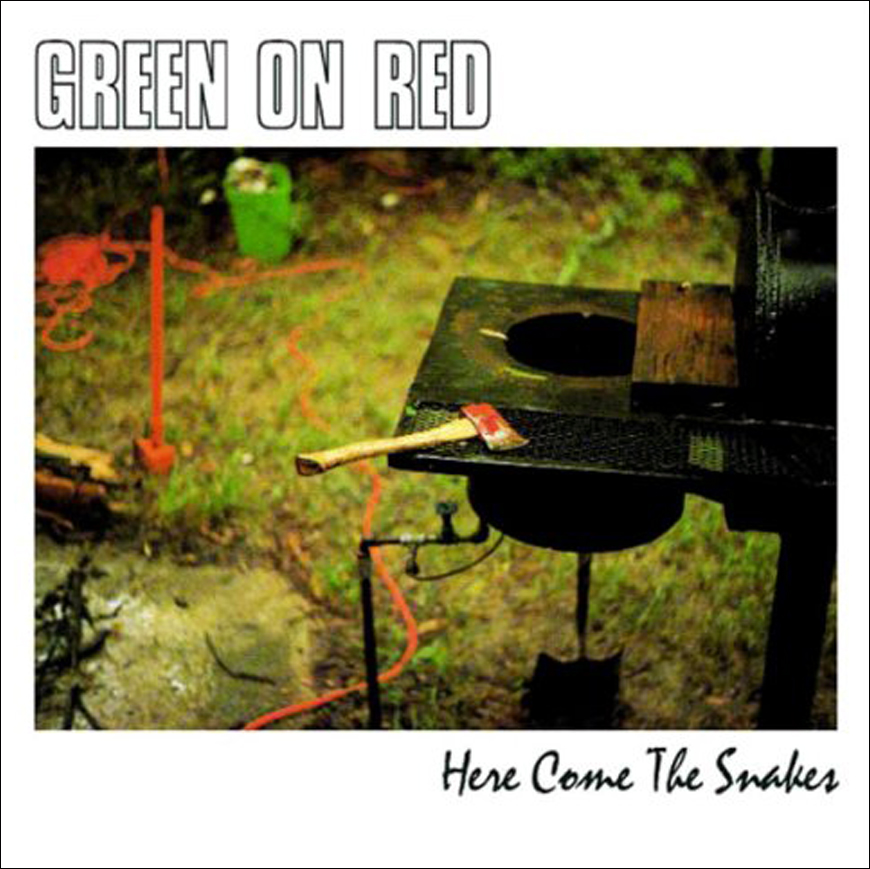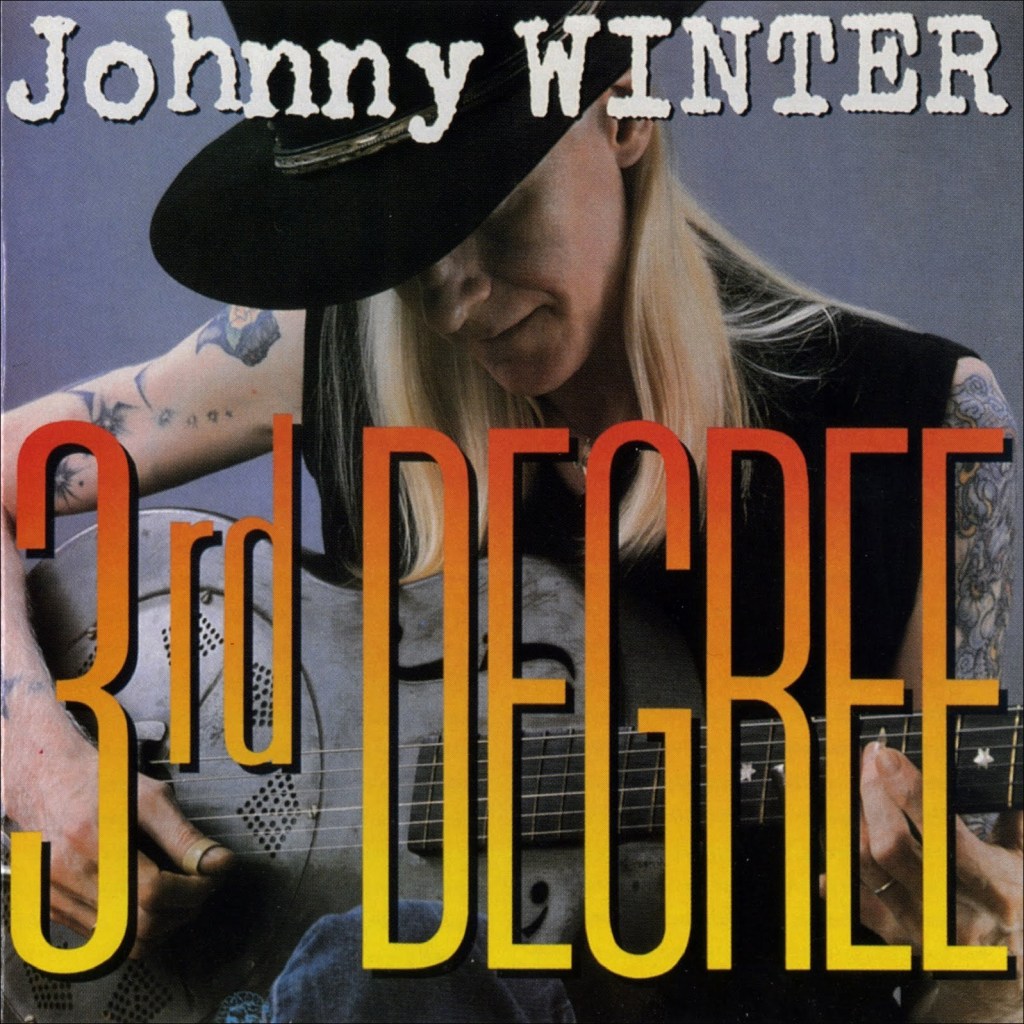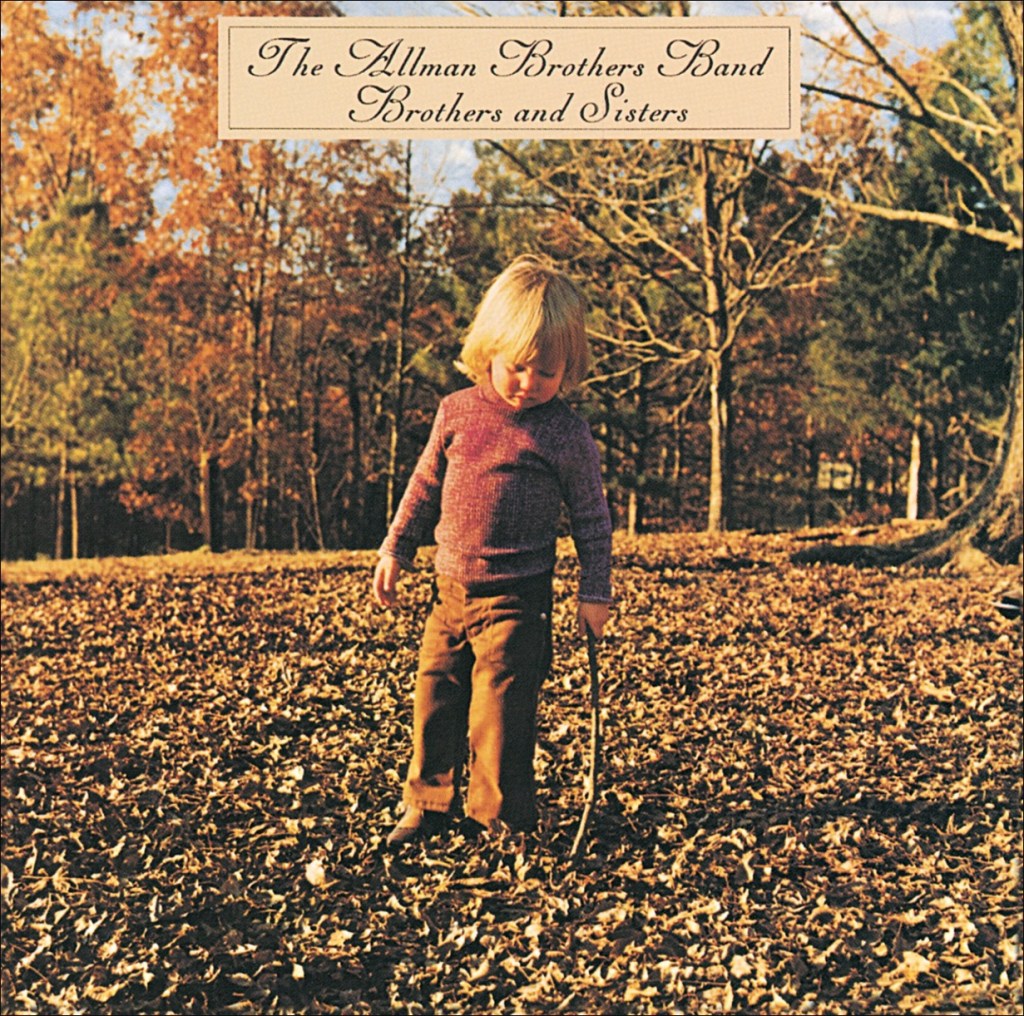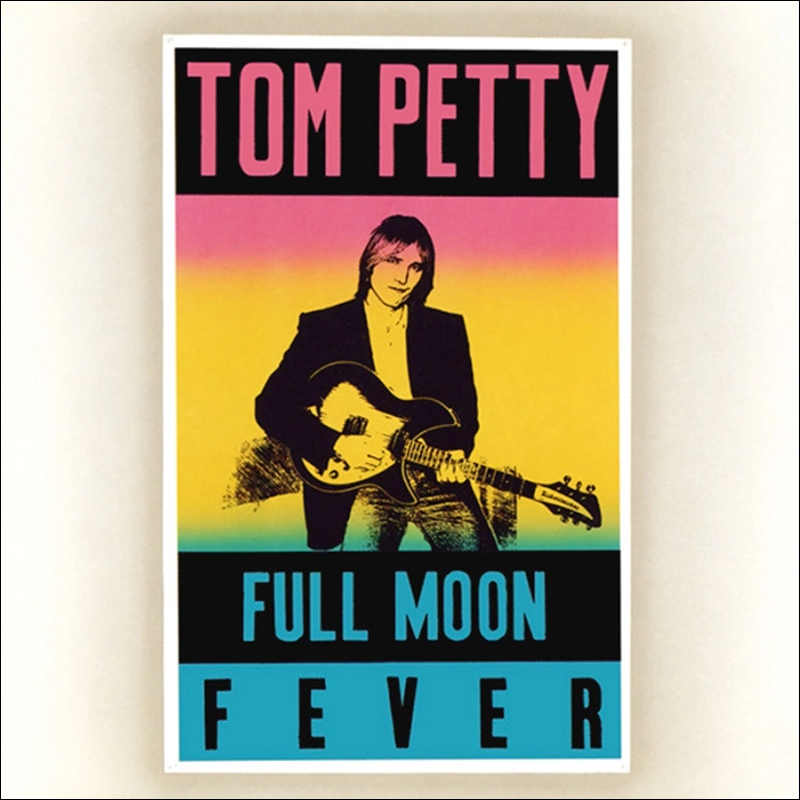Patti Smith, Dream Of Life, 1988
Produzent/ Fred Smith, Jimmy Lovine
Label/ Arista
Patti Smiths Alben und ihre Bücher sind das letzte, über das ich mich streite. Und wenn sie zehnmal ihre Texte mit See, Licht, Wolken, der Erde und Revolution überfrachtet. Sie darf alles. Die Träume, das Engel-Sehen, der Glaube an das Leben nach dem Tod und andere Sentimentalitäten, denn Patti Smith hat sich schon immer daneben ausgedrückt, seit sie im Alter von 28 Jahren angefangen hatte, ihre Idee vom Dichter-Leben in Rockmusik zu intergrieren. Immer nur das tun, was wirklich zu tun ist. Am Anfang waren die Lösungen radikal wie „Horses“, wie der Abbruch der Karriere 1979 nach „Wave“, um eben Karriere zu verhindern und weiterhin das zu tun, was zu tun ist.
„Dream Of Life“, dem Comeback, liegt diese Kombination aus grossem Kitsch und einer herrlichen Zähigkeit zugrunde, mit der Grössenwahn, eine krude Religiosität und auf diesen Pfeilern ruhende Dichtungen und Kompositionen offen und selbstbewusst, weniger hektisch und gehetzt als mit „Wave“ dargebracht werden. Es macht Spass das Album zu hören und mir fällt immer auf wie schön diese Musik ist. Selbst das rockhymnenhafte „Power To The People“ oder das ebenso gearbeitete „Looking For You“ haben eine einfache, schöne Schrabbligkeit, die sie vor dem Aufgehen im Mainstream bewahrt. Wie den alten Wintermantel, immer weiter nutzen. Hauptsache warm.
„Dream Of Life“: Liebe zur Familie, aber dennoch ein Versuch herauszukommen aus der Isolation des Lebens als Privatier. Einblick in die Essenzen der Beat-Poet-Hippie-Bewusstseins-Erweiterungen. Nie feist und fettig werden, dass Schönheit ist, auch wenn wenn sie sich im Unsinn von blühenden Sonnen und Zahlenmystik verirrt: „The dreamer is rising and considers the long field. And the clouds, like crazy eights, drifting horizontal. And his own hands, which hold, even so peacefully, so much power.“