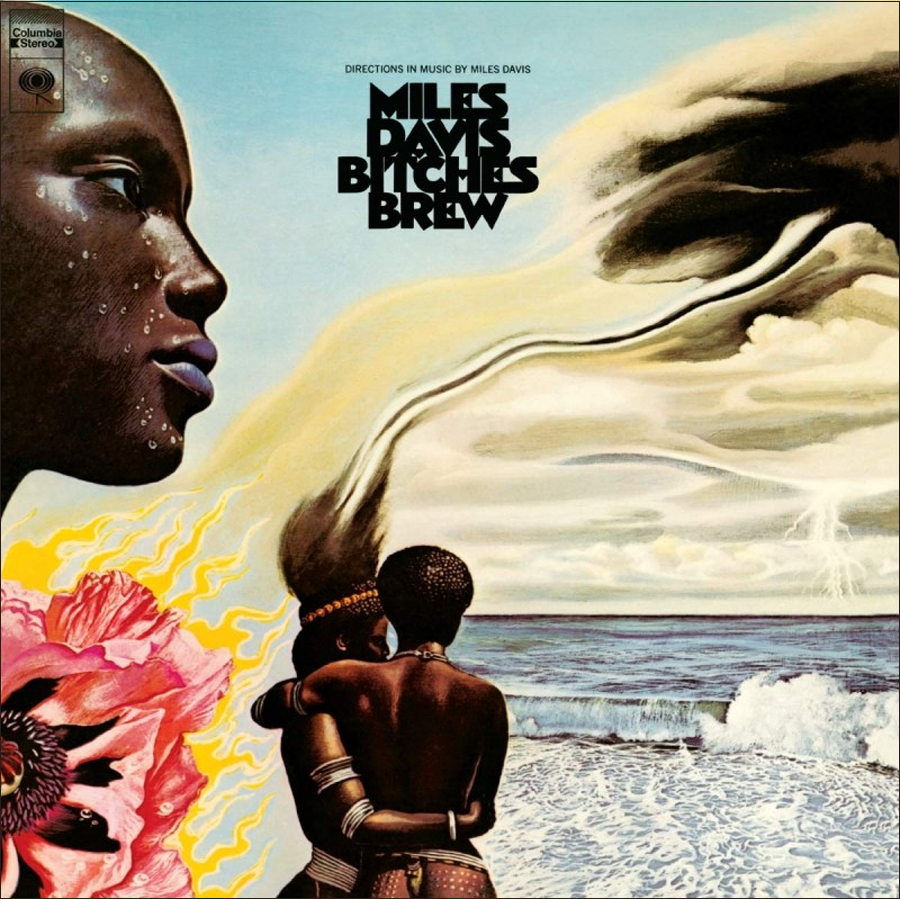Townes Van Zandt, In The Beginning, 2003
Produzent/ Jack Clement
Label/ Fat Possum Records
Townes Van Zandt kam nie auch nur in die Nähe des Startums, oder, um etwas genauer zu sein, die Verkaufszahlen seiner Platten waren (zumindest) zu seinen Lebzeiten himmelschreiend mies. Aber das steht nun gar nicht im Widerspruch zu der Tatsache, dass nicht wenige den texanischen Musiker für die eigentliche Herzkammer des Liedermachens halten. Und so hatten andere mit seinen Stücken, wie z.B. Emmylou Harris und Don Williams mit „If I Needed You“ oder Willie Nelson und Merle Haggard mit „Pancho & Lefty“, grossen Erfolg. Ohne Zweifel war Van Zandt aber auch ein trauriger Mensch, der sich selbst im Weg stand, einer, der leidend und suchtgeplagt war. Depressionen, Alkohol und Drogen besiegten ihn, so dass er 1997 im Alter von 52 Jahren starb. Wer sich für die oft tragische Geschichte von Townes Van Zandt interessiert, sei der Dokumentarfilm „Be Here To Love Me“von Margaret Brown empfohlen, in dem sein Leben informativ und kurzweilig dargestellt wird.
Die Songs von „In The Beginning“ stammen aus dem Jahr 1966, fast zwei Jahre vor der Veröffentlichung des ersten regulären Albums. Es sind simple, im Ohr hängen bleibende Melodien, meist sparsam arrangiert und die oft traurigen Texte sind punktgenau und poetisch; es sind Notsignale aus einem miesen amerikanischen Alltag, die den Staub der Strasse, die Gerüche von Hinterhöfen und den Dunst billiger Kneipen aufgesogen haben. Bei acht der zehn Songs ist Van Zandt solo mit seiner Gitarre zu hören. Der Blues eines Lightinin Hopkins ist genauso präsent wie Folk und Country. Zwei Songs „Hunger Blues“ und „Black Widow’s Blues“ sind mit Band-Back-up. Auch wenn Townes Van Zandt nie ein glücklicher Mensch war, scheint auf wunderbare Weise aber in seiner Musik etwas zu sein, was ihm selbst fehlte: ein Unterschlupf.