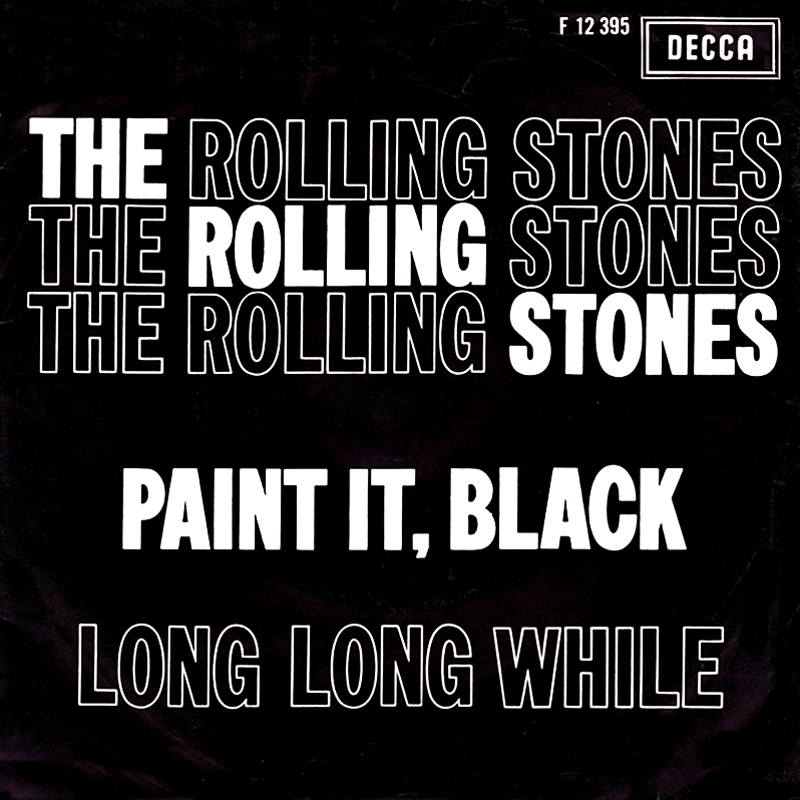Little Richard, Here’ Little Richard, 1957
Produzent/ Bumps Blackwell
Label/ Speciality
Im Sommer 1955 brach plötzlich überall der Rock’n’Roll aus. Innerhalb weniger Wochen kamen Fats Domino, Ray Charles, Chuck Berry und Bo Diddley mit ihren Songs in die Charts. Auch Art Rupe von Speciality Records wollte unbedingt auf dieser Welle surfen. Er befahl seinem besten Talentscout, Bumps Blackwell, einen zweiten Ray Charles zu finden. Bumps fuhr nach Süden und entdeckte im legendären Dew Drop Inn in New Orleans einen extravaganten (und offensichtlich schwulen) Jump Blues Sänger und Pianisten namens Little Richard Penniman. Im September war es soweit: Bumps nahm Little Richard mit in Cosimo Matassas Studio und dort schrieben sie auf einem einspurigen Tonband Musikgeschichte.
Es war reiner Wahnsinn: Richard, Bumps, Cosimo und einige der besten Studiomusiker von New Orleans machten Aufnahmen mit geballter, schamloser, irrer Energie. „Tutti Frutti“ begann den Aufstieg in die Charts im Oktober, während „Long Tall Sally“, „Slippin’ And Slidin’“, „Ready Teddy“ und „Jenny Jenny“ 1956 folgten. Alle diese Hits befanden sich auf „Here’s Little Richard“, gekrönt mit einem unvergesslichen Foto von Richard in Aktion.
Es wurde die erfolgreichste LP des Künstlers. Als Original wird sie sich kaum noch auftreiben lassen, doch die Tracks befinden sich auf vielen Sampler. „Here’s Little Richard“ gehört zu den Stammzellen des Rock’n’Roll – aus diesem Album, und einem halben Dutzend anderer, ist das ganze Genre entstanden.