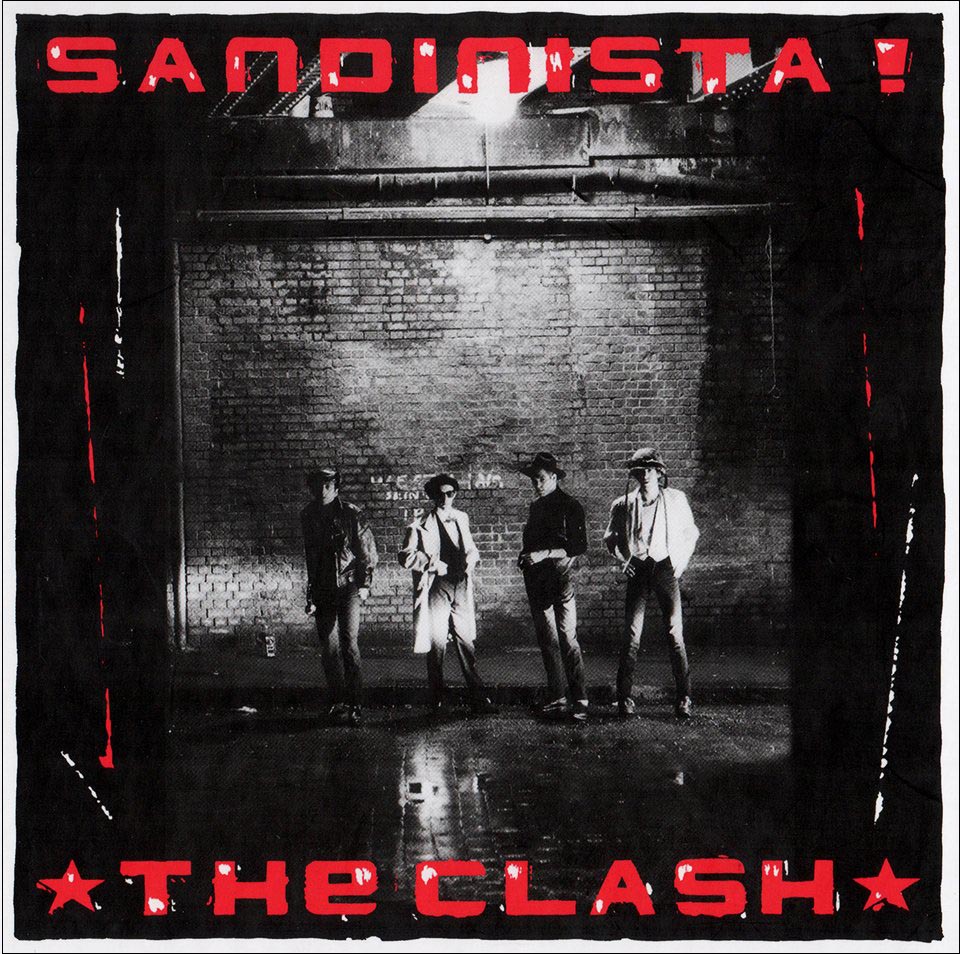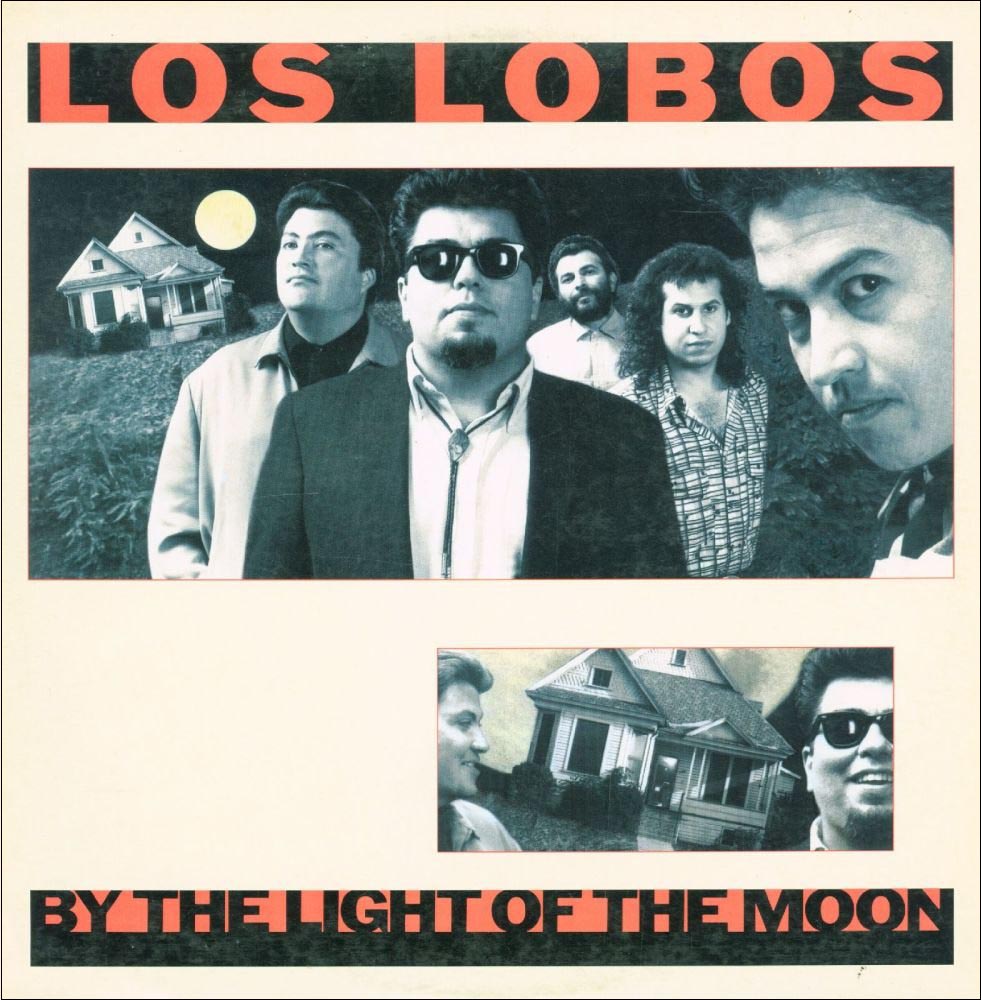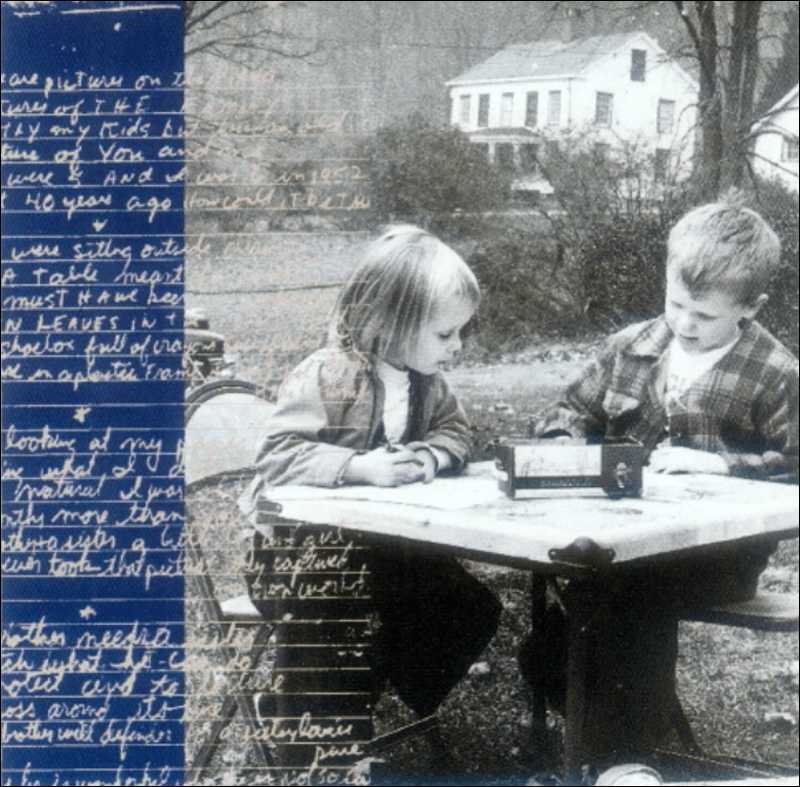J. J. Cale, 5, 1979
Produzent/ Audie Ashworth, J. J. Cale
Label/ Island
Er war ein schweigsamer Typ aus dem Bauernstaat Oklahoma, USA, unrasiert unter dem abgewetzten Hut und in allem schwer zu beeindrucken. Seine mehr gemurmelten als gesungenen Texte kamen einsilbig daher, in denen er die Zeit nach Mitternacht, den Wind, den Mond, die Magnolien, die Liebe und das freie Musizieren besang. Ebenso skizzenhaft klang sein Gitarrenspiel auf der Halbakustischen: Elemente von Blues, Rockabilly und Country in Andeutungen und dazu federnde, zum Singen schöne Melodielinien.
Mit seinem fünften Album, das er auch so benannte, hat er einen Klassiker herausgebracht. Bereits die ersten vier Songs „Thirteen Days“, „Boilin Pot“, „I’ll Make Love Tou You Anytime“ und „Don’t Cry Sister“ gehen sofort ins Ohr und nicht mehr raus. Bei “Too Much For Me“ ist man fast geneigt zu sagen, das ist genau der Titel, der auf vielen Alben anderer Musiker das Highlight wäre, einer dem etwas, aber wirklich nur ganz wenig fehlt, um als Klassiker durchzugehen. Das ist wieder der nächste, das traumhafte schöne „Sensitive Kind“ und das Fahrt aufnehmende groovende „Friday“ – unglaublich was dieser Mann für ein Feeling hat.
J. J. Cale inspirierte mit seinen Songs weit bekanntere Kollegen wie Eric Clapton und die Dire Straits, blieb aber zugleich auf seine konsequente Art bescheiden. Er gehört zu den wenigen Legenden in der Rockmusik, die nicht nur für sich ganz alleine ein Genre geprägt, sondern dieses auch unerreicht über Jahrzehnte besetzt haben.