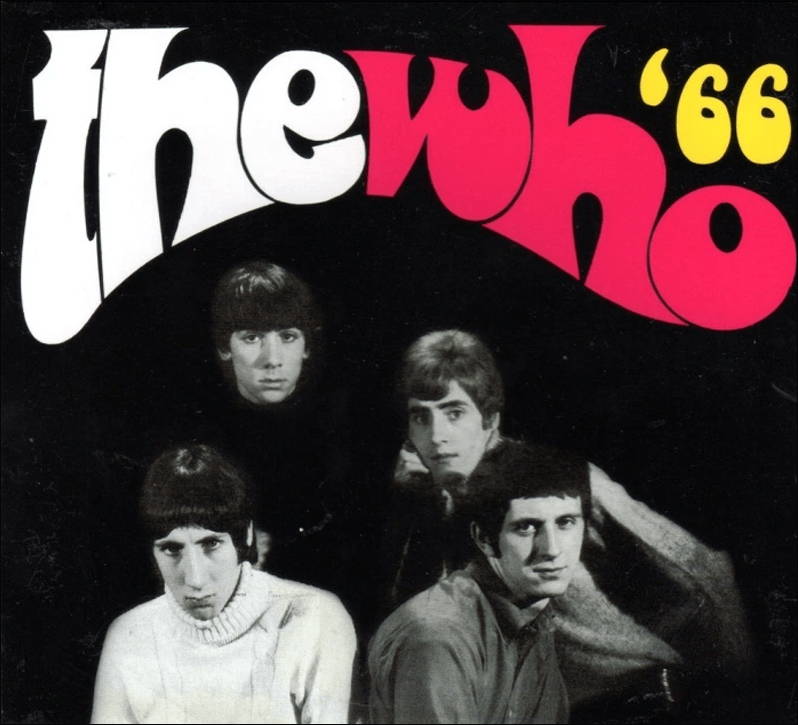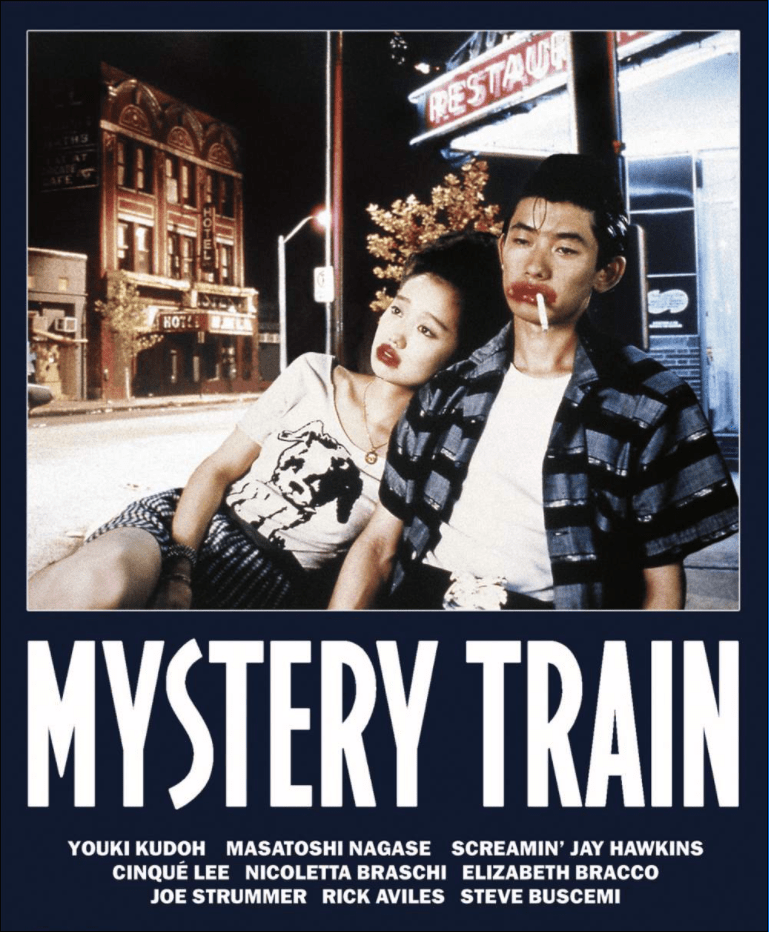The Jesus & Mary Chain, Darklands, 1987
Produzent/ William Reid, Bill Price, John Loder
Label/ Blanco y Negro
Es gibt eine Form des Pop-Songs, wie zum Beispiel „Marmor, Stein und Eisen bricht“ oder „Final Solution“ oder „Heroes“, die nur von dem Gegensatz zwischen einem Abwarten, Zurückhalten im A-Teil und dem Zuschlagen im Refrain lebt. Diese Form perfektionieren The Jesus & Mary Chain auf ihrer zweiten LP. Zu dieser Form, die für die erste grosse Sophistication der Pop-Musik in den mittleren Sechzigern steht, bevor Underground, Wut und Politik und Drogen zur Musik stiessen, verhalten sich The Jesus & Mary Chain etwa so wie sich die Ramones zur Beat/ Trashpop-Form der frühen 60er verhalten.
Wichtig ist, dass bei The Jesus & Mary Chain der Moment des Zuschlagens immer das Einsetzen eines ganz bestimmten, gebremst expressiven Gitarrengewitters ist. Gewitter ist hier ausnahmsweise mal nicht als Metapher gemeint. Das Thema von „Darklands“ ist der Regen („April Skies“, „Happy When It Rains“, „Nine Million Rainy Days“), das sich Senken, das Herabfallen („Fall“, „Down On Me“), die Verdunkelung, das gebremste, gleichmässige Herniedergehen von Gitarrenschrumschrumm, das vorher im A-Teil zurückgehalten wurde, und als Zurückbehaltenes wohl immer präsent war, also eine Entsprechung in den Stimmungen, von denen die Texte sprechen: Text und Musik haben also etwas miteinander zu tun. Jesus & Mary Chain beweisen, dass es das Höchste sein kann, genau zwei Dinge sinnvoll miteinander zu verknüpfen (Text und Musik, oder Melodie und Lärm, A-Teil und B-Teil). Und genau das gelingt ihnen, in ihren auf das Nötigste zusammengeschnurrten Songs, restlos.